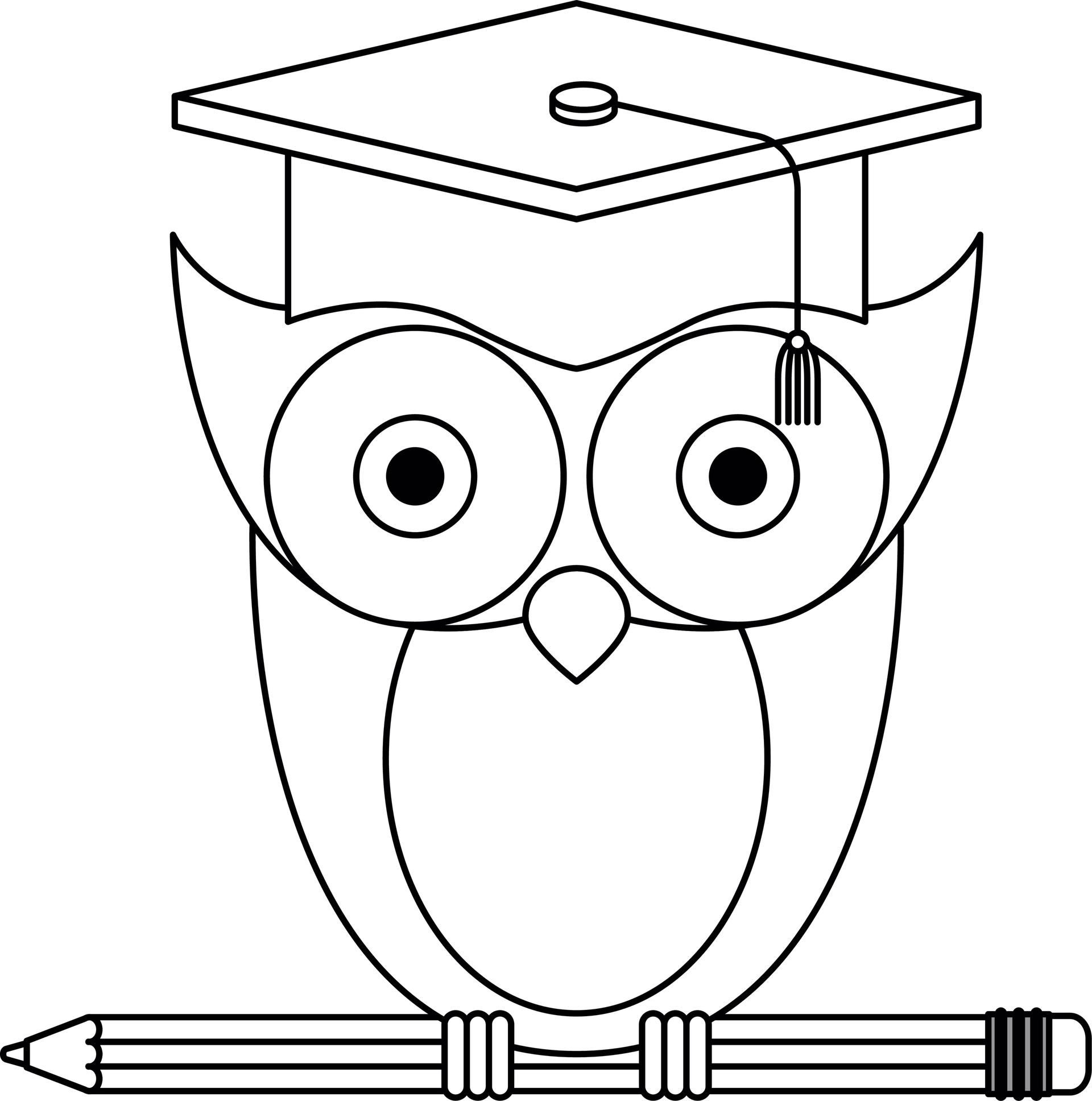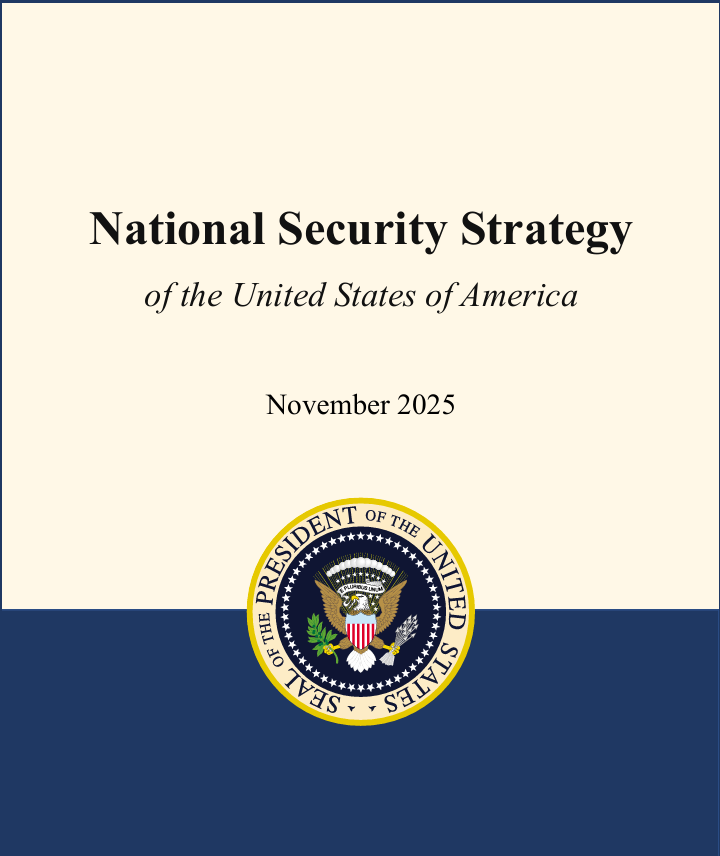
Aus europäischer Sicht mag man darüber spekulieren, ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trumpschen National Security Strategy am 4.12. mit der dreistelligen Millionenstrafe gegen Elon Musks Plattform X (verkündet am 5.12.) durch die Europäische Union zu tun hat. Eine ähnliche Strafe hat es ja bereits im September gegen Google gegeben. Weitere Verfahren gegen US Tech-Giganten – eine Kapitalfraktion, deren Eigentümer zu den reichsten Männern der Welt und den wichtigsten Unterstützern von The Donald gehören – sind in Brüssel anhängig. Vorwürfe über Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Demokratie werden als Umkehr der Tatsachen wahrgenommen und zurückgewiesen, denn sie finden ja gerade unter der Trump-Regierung statt sowie bei deren besonders engen Freunden in Europa. Eine Überempfindlichkeit angesichts der globalen Reichweite des gesamten Papiers einerseits und seiner begrenzten praktisch-politischen Bedeutung als Richtschnur andererseits? National Security Strategies hat es schon viele gegeben: G.W. Bush 2002 und 2006, Obama 2010 und 2015, Trump I 2017, Biden 2021 und 2022. Eine zunehmende Häufigkeit im 21. Jahrhundert mag mit der Volatilität der Weltlage zusammenhängen. Die vorliegende Strategy ist mit 33 Seiten – inklusive Deckblatt und Vorwort – vergleichsweise sehr kurz und pamphlethaft. Seit dem unverschämten Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar sind die Vorwürfe an Europa ja hinlänglich bekannt. Nun hat man es auch noch schwarz auf weiß. Von wirtschaftlichem Niedergang, dem Verlust von Selbstvertrauen und der "starken Gefahr einer zivilisatorischen Auslöschung“ ist da die Rede. Es sei fraglich, ob Europa ein verlässlicher Verbündeter bleibe. Im Zentrum der Kritik steht in der Tat die Europäische Union mit ihrer Regulierungswut sowie multilaterale Regulierungen überhaupt: „The larger issues facing Europe include activities of the European Union and other transnational bodies that undermine political liberty and sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating strife.“ Schon einleitend heißt es unter ‚Prinzipien‘: „We will oppose elite-driven, anti-democratic restrictions of core liberties in Europe, the Anglosphere, and the rest of the democratic world, especially among our allies.“ Und: „We reject the disastrous ‚climate change‘ and ‚Net Zero‘ ideologies that have so greatly harmed Europe, threaten the United States, and subsidize our adversaries.“ Eine Scheidungsurkunde also, wie manche Kommentatoren meinen? Schlimmer! Ein Adoptionsangebot, verbunden mit einer Kriegserklärung gegen universelle Werte wie Menschenrechte, Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat sowie ihre multilateralen Wächter. Europa: „Promoting European Greatness“ Nach allgemeinen Darlegungen zu Zielen, Prinzipien, Strategien und Werkzeugen folgen in der zweiten Hälfte des Papiers die Weltregionen. Der Abschnitt zu Europa ist mit ‚Förderung seiner Größe‘ überschrieben, was wohl nicht als Ausdehnung des Gebiets zu verstehen ist, sondern im Sinne von Großartigkeit. Europa bleibe „strategically and culturally vital to the United States“ . Europa abzuschreiben wäre selbstzerstörerisch. Und: „…the growing influence of patriotic European parties indeed gives cause of great optimism.“ Elon Musks offensive Parteinahme für die deutsche AfD im Wahlkampf kommt da in Erinnerung. Angestrebt ist demnach eine Partnerschaft mit einem Europa der Orbans und Ficos, der AfD und der FPÖ, der PiS, der VOX und des Rassemblement National. Übrigens: Russland wird nur in zwei Absätzen mit seinem Verhältnis zu Europa erwähnt, ansonsten in der ganzen Strategie nicht. In der Tat steht Putin weltanschaulich und gesellschaftspolitisch Trump ja näher als etwa Macron, Starmer oder Sánchez. Beider Denken geht mitunter hinter die Aufklärung zurück. Russland erscheint als wirtschaftlich irrelevant und als keine strategische Bedrohung wahrgenommen zu werden. Die Vision: Eine Welt souveräner Nationalstaaten unter einem starken Führer Auch ansonsten gibt es große Übereinstimmungen in Weltsicht und Selbstbild, angefangen mit der Selbstüberhöhung. Idealbild ist, ähnlich wie bei den Identitären, eine Welt souveräner und kulturell homogener Nationen, die konkurrieren und kooperieren, frei von supranationalen Regulierungen und nach dem Gesetz des Stärkeren. Eine solche Ordnung der Welt sei gottgegeben, Multilateralismus erscheint implizit quasi als Teufelswerk. Die gesamte Strategie ist vom Gedanken an eine natur- oder gottgegebene Überlegenheit der USA als gods own country oder manifest destiny durchtränkt, die teilweise wiederhergestellt werden müsse. An verschiedenen Stellen beruft sie sich auf Gott. Noch häufiger erscheint der Name Trump. „Over the past nine months, we have brought our nation – and the world – back from the brink of catastrophe and disaster. After four years of weakness, extremism, and deadly failures, my administration has moved with urgency and historic speed to restore American strength at home and abroad, and bring peace and stability to our world. No administration in history has achieved so dramatic a turnaround in so short a time. (…) „America is strong and respected again – and because of that, we are making peace all over the world.“ So messianisch beginnt das Vorwort des Präsidenten. Von Russland war bereits die Rede. Einen weiteren Hinweis auf geopolitische Gewichtungen gibt die Länge der jeweiligen Kapitel, wobei Europa mit zweieinhalb Seiten nach Asien und Lateinamerika erst an dritter Stelle kommt, vor Nahost mit zwei und Afrika mit einer halben Seite. Der Nahe Osten erscheint als eine von der Trump-Administration weithin befriedete Region, wo auf der arabischen Halbinsel exzellente Geschäfte winken. Die Rede ist tatsächlich von Frieden, nicht von einem fragilen Waffenstillstand, der täglich gebrochen wird und Todesopfer fordert. Die jeweiligen Regierungs- und Gesellschaftssysteme und ihre Entwicklung solle man dort sich selbst überlassen – im Gegensatz zu Lateinamerika, aber dazu später. Reformen könne man freilich begrüßen. Das gilt auch für die Menschenrechte und offenbar auch für Herrscher, die kritische Journalisten foltern und ermorden lassen. Als geopolitischer roter Faden zieht sich die Eindämmung Chinas durch das ganze Dokument, nicht zuletzt durch das mit sechs Seiten längste, das Asienkapitel. Hier geht es um Marktanteile, legitimen oder unlauteren Wettbewerb und in geostrategischer Hinsicht um die freie Schifffahrt nicht nur im Südchinesischen Meer und um Taiwan, wobei auch hier die Verbündeten einen größeren Eigenbeitrag leisten müssten. Als solche werden ausdrücklich Europa, Japan, Korea, Australien, Kanada und Mexiko genannt. Indien solle hinzugewonnen werden. Um die Zurückdrängung Chinas geht es auch im zweitlängsten Kapitel, dem zu Lateinamerika: „Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine“ Die Überschrift lässt keinen Zweifel daran, worum es geht. Die Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823 definierte Lateinamerika als exklusive Einflusszone der USA und war – keine fünfzig Jahre nach der eigenen Unabhängigkeitserklärung – gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet. Mit der Roosevelt-Corollary (Zusatz) von 1904 behielt sich Washington eine Schiedsrichterrolle bei inneramerikanischen Konflikten und ein exklusives Interventionsrecht vor, wie es bereits in der ersten Verfassung Kubas von 1902 festgeschrieben worden war, das nach dem Sieg im Spanisch-Amerikanischen Krieg den USA zugefallen war. Die Überschrift des Lateinamerika-Kapitels unterstreicht, dass man an diese Tradition anknüpfen will, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Fortsetzung in der containment policy fand, der Eindämmung des „Kommunismus“ - und nach der Revolution von 1959 vor allem Kubas. Unter Marco Rubio, dem Außenminister mit kubanischen Wurzeln, geht es mit anderen Begrifflichkeiten weiterhin darum, vordergründig jedoch um Sicherheit. Nicht im Sinne einer Invasion fremder Truppen über die südliche Landesgrenze, sondern um Migration und Drogen. Darüber hinaus und vor allen Dingen aber geht es um die Zurückdrängung Chinas, den Zugriff auf Rohstoffe und die Schwächung unliebsamer Regierungen, die diesen erschweren. „After years of neglect, the United States will reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere, and to protect our homeland and our access to key geographies throughout the region. We will deny non-Hemispheric competitors the ability to position forces or other threatening capabilities, or to own or control strategically vital assets, in our Hemisphere. This ‚Trump Corollary‘ to the Monroe Doctrine is a common-sense and potent restoration of American power and priorities, consistent with American security interests.“ Dass auswärtige Wettbewerber, zum wirtschaftlichen und strategischen Nachteil der USA, bedeutenden Zutritt zur Region gewinnen konnten, ohne dass sie ernsthaft zurückgedrängt wurden, sei ein großer strategischer Fehler gewesen. „The terms of our alliances, and the terms upon which we provide any kind of aid must be contingent on winding down adversarial outside influence – from control of military installations, ports, and key infrastructure to the purchase of strategic assets broadly defined.“ Die Botschaften der USA sollen sich der Förderung von Geschäftskontakten widmen. „At the same time, we should make every effort to push out foreign companies that build infrastructure in the region.“ Das bezieht sich wohl insbesondere auf den neuen Megahafen in Chancay bei Lima in Peru, der von der chinesischen COSCO gebaut und unlängst eröffnet wurde. Die USA wollen Partner „erster Wahl“ sein … „and will (through various means) discourage their collaboration with others.“ Die Länder der Hemisphäre hätten die Wahl zwischen einer „American-led world of souvereign countries and free economies or a parallel one in which they are influenced by countries on the other side of the world.“ Unter anderem solle auch die Militärpräsenz überdacht werden, was bedeute: „A readjustment of our global military presence to adress urgent threats in our Hemisphere, especially the missions identified in this strategy, and away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years." (Anm. R.L.: siehe die Verlegung der USS Gerald Ford, des größten US Flugzeugträgers, vom Mittelmeer in die Karibik.) (…) „Targeted deployments to secure the border and defeat cartels, including where necessary the use of lethal force to replace the failed law enforcement -only strategy of the last several decades; and Establishing or expanding access in startegically important locations.“ Bereits im einleitenden Teil des Strategiepapiers wird unter ‚Prinzipien‘ deutlich gemacht, dass zwar die Gründerväter in der Unabhängigkeitserklärung den Vorzug für Interventionsverzicht niedergelegt hätten. Aber: „For a country, whose interests are numerous and diverse as ours, rigid adherence to non-interventionism is not possible.“ Die ersten Monate der Trump-Administration gaben reichlich Beispiele dafür, wie man sich das in der Praxis vorzustellen hat: Vom Druck auf die Regierung Panamas, weil ein chinesisches Unternehmen den Ausgang des Panama-Kanals kontrolliere; über Interventionsdrohungen gegen die Regierung Claudia Sheinbaum in Mexiko, damit diese Grenzkontrollen und Drogenbekämpfung intensivieren und militarisieren solle; zu Bestrebungen, den Luftwaffenstützpunkt Manta in Ecuador wieder zu nutzen (was bei einem Referendum von der Wählerschaft zurückgewiesen wurde); über die flagranten Einmischungen in die brasilianische Justiz im Fall des Putschisten Jair Bolsonaro und in die Wahlen in Honduras; bis zum beispiellosen Militäraufmarsch vor der Küste Venezuelas und der Versenkung angeblicher Drogenschnellboote auf offener See, die rein gar nichts zur Linderung der Drogenprobleme in den USA beitragen wird. Letztere bezeichnet der UNO Hochkommissar für Menschenrechte als völkerrechtswidrig und der UN Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismus, der australische Völkerrechtler Professor Ben Saul, spricht von Mord, weil weder eine militärische, noch eine terroristische Bedrohung und schon gar kein Krieg – also auch kein Kriegsverbrechen – vorliege. „Legalität ist eine Machtfrage“ hat Ulrike Meinhof gesagt. Ist es zulässig, eine Terroristin zu zitieren? Vielleicht, wenn es um Terrorismus geht, um die Frage, ob es sich – wie von der Trump-Administration behauptet – um „Narcoterrorismus“ handelt oder um „Staatsterrorismus“. Es muss nicht wirklich verwundern, wenn bei schwierigeren Bedingungen für die Kapitalakkumulation, schärferer Weltmarktkonkurrenz, knappen Rohstoffen und multiplen Krisen Vernunft und gute Sitten über Bord geworfen werden, wenn bellizistische Rhetorik üblich wird, wenn Völker- und Menschenrecht dem Feuilleton überlassen bleiben. Bemerkenswert ist, dass es sich im vorliegenden Papier vielfach um die pseudo-konzeptionelle Untermauerung der realen politischen Praxis handelt, statt um eine Strategie für die Zukunft. Mehr als alles andere wird die Großartigkeit der Vereinigten Staaten und ihres aktuellen Präsidenten beschworen. Anders als im vorliegenden Dokument stehen sich im realen Leben nicht einfach Nationalstaaten gegenüber. Noch gibt es auch in den Vereinigten Staaten eine Opposition, zivilgesellschaftliche Organisationen, unterschiedliche veröffentlichte Meinungen. Der diesseits des Atlantiks üblich gewordene Kotau gegenüber Trump und seiner Regierung ist nicht einfach nur peinlich. Er lässt ihn zuhause erfolgreich dastehen und stärkt ihm den Rücken gegenüber seinen Kritikern. Ob die Lateinamerikaner – Progressisten oder Konservative – von der ihnen zugedachten Rolle als Arena des Ringens zweier Großmächte oder schlicht als Untergebene begeistert sein werden? Bisher gibt es kaum Reaktionen. Interessant ist ferner, was nicht in der Strategie steht: Von einer Einverleibung Kanadas ist so wenig die Rede wie vom Kauf Grönlands. Übrigens: Es gibt auch durchaus richtige Wahrnehmungen und bedenkenswerte Einschätzungen in dem Dokument, das einmal mehr Einblick in die Denkweise seiner Väter gibt. Die darin zum Ausdruck gebrachte Weltsicht ist gefährlich anachronistisch. https://www.whitehouse.gov/up-content/uploads/2025/2025-National-Security-Strategy.pdf
Der Wahlsieg war mit 54:45 Prozent in der Stichwahl ebenso überzeugend wie insgesamt überraschend. Rodrigo Paz Pereira ist auf der großen politischen Bühne seines Landes ein Newcomer. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 17. August hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Seine politische Karriere begann er im Jahr 2002 als Abgeordneter des Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Bewegung der Revolutionären Linken - MIR), das sein Vater, Jaime Paz Zamora (später 60. Präsident von 1989 bis 1993), im Jahr 1971 während der Zeit der Militärdiktaturen im chilenischen Exil mitbegründete. Zwischen 2015 und 2020 war Paz Pereira Bürgermeister seiner Heimatstadt Tarija und ab 2020 Senator von Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadana . Nun gewann er auf dem Ticket der bisher bedeutungslosen Christdemokratischen Partei (PDC) zunächst mit 32,06 Prozent der Stimmen vor dem zweiten Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre ) mit 26,7 Prozent. Die Linke, die mit dem Movimiento al Socialismo (MAS) in den letzten zwei Jahrzehnten seit 2005 stets absolute Mehrheiten erzielt hatte, ist zersplittert und in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. (Wir berichteten in diesem Blog: "Bolivien: Totalschaden für die Linke" und frühere Beiträge.) Das heißt auch: Im Parlament wird sich die neue Regierung Mehrheiten suchen müssen. Der ursprünglich favorisierte Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad ), der unter Vater Jaime Paz einmal Minister war, landete auf dem dritten Platz und hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt. Ebenso wie der in Umfragen vor der Stichwahl ebenfalls favorisierte klare Verlierer „Tuto“ Quiroga (54:45 Prozent). Alle drei „Parteien“ sind rechts der Mitte zu verorten. Zusammen kämen sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Vergangenheit hatte bei Bedarf die US-Botschaft solche Allianzen geschmiedet. „Kapitalismus für alle…“ …lautet Paz‘ Versprechen. Bolivien ist ein Land ohne Kapitalisten (sprich: unternehmerische Tradition). Bis 1952 beherrschten drei Zinnbarone die wirtschaftlichen und politischen Geschicke. Nach der Revolution von 1952/53 folgte eine Periode des Staatskapitalismus, die politisch unter anderem deshalb scheiterte, weil sich mit Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce und Juan Lechín mehrere Caudillos um die Kontrolle des regierenden Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) stritten. Eine Parallele zur Aktualität: Um die MAS und ihr Erbe stritten sich vor ihrem Niedergang Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez und Eduardo del Castillo. Seinerzeit folgten von 1964 bis 1982 lange Jahre teilweise blutiger Militärdiktaturen. Der Staatskapitalismus dauerte an. Ihm folgte ab 1982 eine gewählte Linksregierung, die 1986 an einer Hyperinflation zerbrach. Der Führer der Revolution von 1952, Víctor Paz Estenssoro, gewann die Wahlen und leitete eine neoliberale Strukturanpassung nach Vorgaben des IWF ein, die bei hohen sozialen Kosten makroökonomische Stabilisierung brachte. Für die maroden Staatsbetriebe wollte sich aber fast ein Jahrzehnt lang kein Käufer finden, bis sie in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Sonderkonditionen überwiegend an ausländische Investoren verhökert wurden. Bolivien wurde zum Aid Regime, ausländische „Entwicklungshilfe“ zum Akkumulationsersatz. Das interne Steueraufkommen reichte oft nicht einmal aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Ein Jahrzehnt später war das Modell gescheitert und die MAS übernahm im Januar 2006 nach einem Erdrutschsieg das Ruder. Das Wirtschaftsmodell soll heute also weniger staatszentriert sein und mehr auf Marktwirtschaft und Privatinvestitionen setzen. Vor allem aber wird es auf Auslandsfinanzierung angewiesen sein. In der Ministerriege fallen erfahrene Technokraten auf. Einige haben für die Vereinten Nationen gearbeitet, andere waren vor 2006 schon einmal Minister. Die Umstellung dürfte weniger rabiat erfolgen als unter der selbsternannten Interimsregierung, die nach der Machtergreifung der Rechten im November 2019 ein Jahr lang nach Kräften versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder auch unter Quiroga, der bereits unter dem Exdiktator Hugo Banzer (1997-2001) einmal als Vizepräsident und nach dessen Krebstod ein Jahr lang bis 2002 auch als Präsident einen strikt neoliberalen Kurs fuhr. Leicht wird es nicht werden. Die Kassen sind leer und das Land leidet seit Monaten unter Treibstoff- sowie Devisenknappheit. Gleich am Tag nach der Amtseinführung konnte der neue Präsident einen Lkw-Konvoi mit hunderten von Zisternen voll Treibstoff begrüßen. Erinnerungen an Chile 1973 drängen sich auf. Eine erste Auslandsreise hatte den designierten Präsidenten schon vorher nach Washington geführt, von wo er Kreditzusagen (die Rede ist von sechs Milliarden US-Dollar) mitbrachte sowie eine Vereinbarung, umgehend wieder diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Zur Erinnerung: Präsident Morales hatte diese nach dem Zivilputsch vom September 2008 abgebrochen; zur Jahrtausendwende entsprachen ausländische „Entwicklungshilfen“ jeweils etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Amtseinführung waren Vertreter Nicaraguas, Venezuelas, Kubas und des Iran ausdrücklich nicht eingeladen. Ein deutliches Zeichen für den Kurswechsel in der Außenpolitik. Ohne Basis, Programm und Struktur Die PDC ist eine Partei ohne Programm und ohne Basis. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt aber ein Spiegelbild der bisherigen Polarisierung. Paz gewann die Stichwahl in sechs von neun Departements (in La Paz, Cochabamba, Potosí und Oruro mit mehr als 60 Prozent). Quiroga gewann in den Tieflanddepartements Santa Cruz und Beni; nahezu gleichauf lagen beide in Tarija. Darin zeigt sich noch einmal die Tragik des politischen Versagens der MAS. Deren frühere Wählerinnen und Wähler im Hochland entschieden sich nun doch eher für die moderate Rechte, zumal der Vizepräsidentschaftskandidat von Libre , Juan Pablo Velasco, wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen war. Damit ist nicht gesagt, dass die neue Regierung auch auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Wählerklientel eingehen wird. Bei der konnte nicht zuletzt der nunmehrige Vizepräsident Edmand Lara punkten, ein Polizist, der aus dem Dienst entlassen worden war, nachdem er Polizeikorruption angeprangert hatte. Der erklärte Bewunderer des salvadorianschen Präsidenten Nayib Bukele erwarb sich so einen Ruf als unbestechlicher Korruptionsbekämpfer und besticht selbst durch fleißiges Posten populistischer Äußerungen auf TikTok. Seinen Amtseid legte er in Polizeiuniform ab. Es gibt Beobachter die meinen, mit ihm als Spitzenkandidat hätte die PDC im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen können. Dementsprechend fällt Lara durch großes Selbstbewusstsein und Ambitionen auf, beklagt mangelnde Kommunikation von Paz mit ihm und betont bei jeder Gelegenheit, er würde in der Regierung nicht fünftes Rad am Wagen sein. Möglich, dass Lara sich als stärkste Oppositionskraft in der eigenen Regierung herausstellt. Übrigens: Laras Frau wurde – wie Quirogas Schwester – schon im ersten Wahlgang auf einem sicheren Listenplatz Abgeordnete. Kapitalismus für alle, das Versprechen dürfte sich neben ausländischen Investoren vielleicht noch für eine neue Mestizo-Bourgeoisie erfüllen, die gestärkt aus dem proceso de cambio der MAS-Jahre hervorgegangen ist. Sie sorgt sich um ihr kürzlich erworbenes Vermögen, scheut staatliche Kontrolle und Interventionismus, möchte aber auch nicht gänzlich auf Regulierung verzichten. Die Umverteilungspolitik der MAS beruhte auf dem Export von Erdgas und Erdöl, auf Extraktivismus, und war von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten abhängig. Die Erschließung neuer Quellen hatte man vernachlässigt, auf Diversifizierung lange verzichtet. Obwohl Bolivien wahrscheinlich auf den weltweit größten Lithiumvorkommen sitzt und man von Anfang an gute Konzepte hatte – nicht nur den Rohstoff wollte man exportieren, sondern zumindest Batterien – ist auch dabei nichts Zählbares weitergegangen. Nachdem sich die Europäer 2019 selbst aus der Poleposition geschossen hatten, auch nicht mit zuletzt chinesischen und russischen Partnern. Die Herausforderungen sind groß. Der informelle Sektor ist weiter angewachsen. 85 Prozent der Menschen sollen ganz oder teilweise auf ihn angewiesen sein. Das Budgetdefizit lag 2024 bei 10,62 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jährlich wiederkehrende Großfeuer und die Vergiftung von Flüssen durch Goldsucher stellen große ökologische Herausforderungen dar. Ob es gelingt, den Kokainhandel weiterhin einzudämmen, ist eine Frage. Hier wird derzeit heiß über eine mögliche Rückkehr der Drug Enforcement Administration (DEA) diskutiert, die aus Gründen der nationalen Souveränität von Morales zusammen mit der US-Botschaft des Landes verwiesen worden war. Schließlich stehen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Verfasstheit an: Im zweiten Kabinett Morales gab es einmal Geschlechterparität. Darüber hinaus ist so wenig passiert wie beim Umweltschutz – den "Rechten der Pachamama“. Feminizide sind an der Tagesordnung. Die öffentliche Sicherheit ist generell ein wachsendes Problem, das Gefängniswesen katastrophal. Fälle indigener Autonomien lassen sich, anderthalb Jahrzehnte nachdem sie vielbeachtetes Novum in der neuen Verfassung waren, an den Fingern einer Hand abzählen. Immerhin: Im Gegensatz zu politischen Gegnern wie Quiroga steht Rodrigo Paz zu Bolivien als plurinationalem Staat, wie er in der Verfassung von 2009 verankert ist, und nicht für eine Rückkehr zur Republik, die stets excluyente und diskriminierend war. Schon in der Woche nach der Amtseinführung wurde ein Dialog mit der Justiz gestartet. Deren erbärmlicher Zustand war mit unterschiedlichen Urteilen zum passiven Wahlrecht von Morales, je nach Maßgabe der jeweiligen Machtverhältnisse, unübersehbar geworden und erreichte bereits in der Woche nach den Wahlen mit der Einstellung von Verfahren sowie der Freilassung von Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom November 2019 seinen Höhepunkt. Zuletzt wurde auch die „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez freigelassen, die den Sicherheitskräften per Dekret Straffreiheit zugesichert hatte. Im nunmehr eingestellten Verfahren ging es unter anderem um die Massaker von Sacaba (15.11.) und Senkata (19.11.) mit zusammen mehr als 20 Todesopfern. Just während dieser Beitrag online ging, hat Präsident Paz den frischernannten Justizminister Freddy Vidovic entlassen, der eine Vorstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes verschwiegen hatte. Vidovic war Anwalt Laras gewesen und der einzige von dessen Gefolgsleuten im Kabinett. Nur Stunden später löste Paz gleich das ganze Justizministerium auf. Ob das der richtige Weg ist? Von der Straffreiheit zur „Unterhaltsamkeit“? Die Absolution für die formal verantwortliche Frau Añez, die von MASistas als „fotogene Barbiepuppe der Putschisten von 2019“ und „Bauernopfer“ angesehen wird, mag nach fünf Jahren gerecht erscheinen. Gingen doch aktive Täter leer aus und wichtige Drahtzieher haben bei den zurückliegenden Wahlen sogar kandidiert, während sie im Frauengefängnis von Miraflores saß. Unterdessen wurde der glücklose Amtsvorgänger Luis Arce, der inzwischen wieder Wirtschaftsvorlesungen an der UMSA ( Universidad Mayor de San Andrés ) gibt, von den Verwaltern des Parteikürzels MAS (die mit 3,1 Prozent der Stimmen gerade noch Parteistatus behalten durfte) aus der Partei ausgeschlossen. Ein weiteres Bauernopfer? Soll so womöglich der Weg für eine Rückkehr von Morales bereitet werden? Letzterer sitzt weiterhin unter dem Schutz seiner Getreuen in einer tropischen Palisadenfestung in seiner Hochburg, dem Kokaanbaugebiet des Chapare. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen ist. Ihm wird vorgeworfen, mit einer seinerzeit 15-jährigen ein Kind gezeugt zu haben. Weil ihm wiederholt minderjährige Frauen ins argentinische Exil zugeführt worden sein sollen, lautet ein weiterer Vorwurf auf Menschenhandel. Mit seinem Aufruf, aus Protest gegen die Nichtzulassung zur Kandidatur ungültig zu wählen, landete der Hauptverantwortliche für den Zerfall der MAS im ersten Wahlgang indirekt immerhin bei rund 15 Prozent, mehr als die anderen Konkurrenten auf der Linken zusammen. Während die sich weiterhin in einer Art Schockstarre zu befinden scheinen, mischt Morales mit seinem kommunalen Radio bereits wieder in der politischen Auseinandersetzung mit. Von einem „Delinquenten mit Territorium, Radiostation und Straflosigkeit“, den man stoppen müsse, sprach der Präsidentenvater Jaime Paz Zamora. Morales sprach ihm seinerseits „die Moral“ zu urteilen ab, weil er in betrunkenem Zustand einen Passanten totgefahren und seinerzeit „Ströme von Blut“ durchschwommen habe, als er 1989 mit dem Exdiktator Banzer koalierte, um den Wahlsieger „Goni“ Sánchez de Lozada auszubremsen und selbst Präsident zu werden. (Vor den Wahlen hatte Jaime Paz damals erklärt: „Von Banzer trennen uns Ströme von Blut“. „Goni“ wurde später zweimal Präsident und noch später im Exil von einem US-Gericht wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt.) Es verbietet sich natürlich, vom Vater auf den Sohn zu schließen. Der erklärte, man habe nicht ein Land im Stillstand übernommen, sondern eine „Kloake der Korruption“ und spricht von „veruntreuten 15 Milliarden Dollar oder mehr“. Was aus den einstmals so starken sozialen Bewegungen wird, ob sie sich erholen? Auch sie sind tief gespalten. Gerade wurde der kürzlich als Chef des mächtigen Gewerkschaftsbundes COB zurückgetretene Juan Carlos Huarachi wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Damit scheinen zumindest einige Wegweiser erkennbar, wie es politisch in Bolivien weitergehen könnte, das bis 2005 fast zwei Jahrhunderte lang als instabilstes Land Lateinamerikas gegolten hatte. Rechtsradikale und Kettensägenpolitiker scheinen dem Land vorerst erspart geblieben zu sein. Doch es könnte „unterhaltsam“ werden – zumindest für unbeteiligte Beobachter.

Während die eigentliche certification für drogenpolitisches Wohlverhalten erst im kommenden Frühjahr verkündet wird, ist der Grundlagenbericht dazu bereits fertig und hat insbesondere in Kolumbien Staub aufgewirbelt. Zusammen mit Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela wird dem traditionell engsten Verbündeten der USA in Südamerika bescheinigt, dass er im zurückliegenden Jahr seinen drogenpolitischen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei ( demonstrably failed wie es heißt). Präsident Gustavo Petro protestierte, hat Waffenkäufe eingefroren und beschuldigt Washington, sich in den Wahlkampf einzumischen. Die mit einer decertification verbundenen Sanktionen wurden aber aus Gründen der nationalen Sicherheit ausgesetzt. Kurios ist das Verdikt im Fall Afghanistan, das ohnehin Sanktionen unterliegt. Dort steigt zwar die Produktion von Cannabis und Amphetaminen. Der Anbau von Schlafmohn wurde im weltweit wichtigsten Ursprungsland für Heroin von den Taliban aber um 95 Prozent reduziert. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen 20 Jahren westlicher Sicherheitskooperation unter Führung Washingtons, wo Schlafmohnanbau und Heroinproduktion alljährlich neue Rekordhöhen erreicht hatten. Nebenbei: Für die USA ist Afghanistan drogenpolitisch eher uninteressant. Ihre illegalen Märkte werden aus Lateinamerika beliefert, insbesondere aus Mexiko und Kolumbien. Auf internationaler Ebene wird das alljährliche Zertifizierungsritual Washingtons schon lange nicht mehr ernst genommen. Pure Symbolpolitik also? Nicht ganz, denn für die Regierung der Vereinigten Staaten ist es ein sehr preiswertes Druckmittel. So nahm die Opposition in Kolumbien den Steilpass aus Washington vor den im Mai 2026 stattfindenden Wahlen dankbar an. Die Linksregierung Gustavo Petro würde den Ruf des Landes ruinieren und ausländische Investitionen gefährden, so etwa die Journalistin und konservative Präkandidatin Vicky Dávila. Das Weiße Haus unterstreicht darüber hinaus, dass sich die Entscheidung ausdrücklich auf die politische Führung des Landes beziehe und lobt die Fähigkeiten und den Mut der kolumbianischen Sicherheitskräfte. US-Außenminister Rubio legte noch nach und nannte Präsident Petro einen „Agenten des Chaos“, seine Politik „irrlichternd“. Zuletzt wurde ihm sogar das Einreisevisum in die USA entzogen. Das renommierte Washington Office on Latin America (WOLA) hingegen kommentierte: Die jahrzehntealte Praxis, andere Staaten durch die certification für ihre angeblich mangelhafte Drogenpolitik zu beurteilen und zu bestrafen, sei ein antiquiertes, grobschlächtiges und kontraproduktives außenpolitisches Instrument und sollte abgeschafft werden. Näheres zu den drogenpolitischen Fakten in Kolumbien und den Ursprüngen der certification im vorangegangenen Beitrag „Drogen: Kolumbien im Visier“. Kanonenbootpolitik Der Militäraufmarsch der USA vor der venezolanischen Küste hat inzwischen Gestalt angenommen und zu ersten Opfern geführt. Am 2. September berichtete Präsident Trump auf seinen sozialen Kanälen, im Rahmen einer von ihm selbst ausdrücklich angeordneten Operation sei ein Boot der venezolanischen „ Tren de Aragua narcoterrorists“ versenkt worden. Ein unscharfes Video zeigte, wie ein mit mehreren Personen besetztes Boot in Flammen aufgeht. Stand heute (27.9.) sollen es vier Schnellboote sein. Die Zahl der getöteten Menschen soll inzwischen bei 17 liegen. Nur im letzten Fall wurden anschließend tatsächlich Drogen aus dem Wasser gefischt. Dominikanische Sicherheitskräfte wollen 1.000 Kilogramm Kokain sichergestellt haben. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei jedenfalls um außergerichtliche Tötungen. Gleich der erste, am besten dokumentierte, Fall, wirft Fragen auf. Weder wurden Drogen präsentiert, noch irgendwelche Beweise vorgelegt, dass das Boot für die Organisation „ Tren de Aragua “ unterwegs war. Nach Recherchen der investigativ-journalistischen Plattformen „The Intercept“ und „InSight Crime“ war das Boot im venezolanischen Bundesstaat Sucre gestartet und hatte außergewöhnlich viele Personen an Bord. Die Rede ist von 11. Die fragliche Route werde für Schmuggelgut aller Art und auch von Migranten genutzt. Ein Versuch, das Boot zu stoppen und zu beschlagnahmen sowie die Besatzung zu verhaften, wurde nicht unternommen, obwohl es nach Darstellung des Außenministers Marco Rubio möglich gewesen wäre. Vielmehr habe es nach einem ersten Angriff umgedreht, sei dann aber durch eine Drohne weiter beschossen worden und in Flammen aufgegangen. WOLA spricht von einer Gruppenexekution auf hoher See. „Polizeiliche Fahndung bringt nichts“, sagte Marco Rubio dazu auf einer Pressekonferenz in Mexiko: „Was sie stoppen wird ist, wenn du sie in die Luft jagst.“ Das Vorgehen ist freilich nicht neu und erinnert an die Operation Airbridge Denial . Ab Mitte der 1990er Jahre waren nicht identifizierte Kleinflugzeuge, die im Verdacht standen, das Zwischenprodukt Pasta Básica de Cocaína aus den Anbaugebieten in Bolivien und Peru zur Weiterverarbeitung nach Kolumbien zu transportieren, zur Landung gezwungen oder notfalls abgeschossen worden. Im April 2001 führte anscheinend ein Kommunikationsfehler zwischen dem US-Aufklärer und dem peruanischen Jäger zum Abschuss einer Cesna mit einer US-Missionarsfamilie an Bord. Zwei Menschen starben und der Congress in Washington stellte Fragen. Das Programm wurde eingestellt. Der Unterschied ist die Unilateralität: Heute sind US-amerikanische Soldaten auch am Abzug. Zu Recht wird die Begründung kritisiert, es handle sich um eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der gewinnorientierte Drogenhandel, ein kleines Schnellboot gar, soll eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen? Dieser juristische Winkelzug – also die Definition von organisierten Verbrechern des Drogenhandels zur Terrororganisation – dient dazu, dass man nach US-Recht das Militär gegen sie einsetzen darf. Auch dies ist nicht neu. Die Administrationen der Präsidenten Bush und Obama rechtfertigten mit dem „Krieg gegen den Terror“ außergerichtliche Tötungen von Al Qaeda- und Taliban-Führern. Und Präsident Ronald Reagan argumentierte bereits zu Beginn des Jahres 1986 in einer National Security Decision Directive , Drogen seien zu einer Bedrohung der Nationalen Sicherheit geworden. Das diente damals schon dazu, mit den Anti-Drogen-Gesetzespaketen von 1986 und 1988 das Militär in die Drogenkontrolle einzubeziehen. Zunächst an den US-Außengrenzen ( border interdiction ), dann auch in den sogenannten Produzentenländern ( going to the source ). Hohe Militärs wandten damals dagegen ein, sie seien dafür nicht ausgebildet. Search and destroy sei ihre Aufgabe, nicht Verhaftung und Beweisaufnahme. Wenn man sich das Ausmaß der seitdem angewachsenen Drogenimporte und des Drogenkonsums vor Augen führt, so kann man nur sagen: Die Militarisierung der Drogenkontrolle war ein absoluter Holzweg mit sehr hohen Nebenkosten: Teuer, wirkungslos und mit Verletzungen von Menschenrechten sowie der nationalen Souveränität der betroffenen Länder verbunden. Mehrere Kriegsschiffe, ein atomgetriebenes U-Boot und insgesamt 4.000 Soldaten sollen am aktuellen Aufmarsch beteiligt sein. Zehn Kampfjets wurden nach Puerto Rico verlegt, einer nach Guyana, das sich im Grenzstreit mit Venezuela befindet. Der venezolanische Präsident Maduro persönlich wird beschuldigt, in den Drogenhandel verstrickt zu sein, ohne dass dafür Beweise vorgelegt wurden. Auf ihn wurde ein Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen US Dollar ausgesetzt. Venezuela mobilisierte seine Reservisten, und Maduro 2.500 Soldaten und 12 Kriegsschiffe zu einer Militärübung Operation Souveräne Karibik 200 , erklärte aber gleichzeitig seine Gesprächsbereitschaft. Der frühere Chef des US Southern Command, General James Stavridis, fand klare Worte: „ Gunboat diplomacy is back, and it can work .“ Die Regierungen Mexikos, Kolumbiens und Brasiliens warnten vor der Gefahr einer militärischen Konfrontation. Der sagenhafte fliegende Holländer ist dazu verdammt, ewig die Meere zu durchsegeln ohne jemals einen Hafen (ein Ziel) zu erreichen. Die europäischen Verbündeten haben in der Vergangenheit stets alle drogenpolitischen Absurditäten Washingtons und andere außenpolitische Abenteuer (stillschweigend) mitgetragen. Kann der politische Wiedergänger und derzeitige Kapitän des Geisterschiffs auch heute darauf bauen?
Noch vor der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses ist die Lage klar: In die Stichwahl am 19. Oktober kommen Rodrigo Paz Pereira von den Christdemokraten (PDC mit vorläufig 32,09 Prozent der Stimmen) und der Rechtskonservative Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre mit 26,93). Dahinter liegt auf Platz 3 der liberale Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad Nacional mit 19, 92). Es folgten der vormalige MAS-Senatspräsident Andrónico Rodríguez ( Alianza Popular 8,11), der Bürgermeister von Cochabamba Manfred Reyes Villa ( Sumate 6.63) und der vormalige Innenminister Eduardo del Castillo (MAS, im Bild), der mit 3,14 Prozent gerade noch die Dreiprozenthürde nehmen konnte. Bei der Stichwahl zwischen Paz und Quiroga geht es im präsidentialistischen Bolivien um das besonders wichtige Präsidentenamt. Sieht man sich die voraussichtliche Sitzverteilung im Zweikammernparlament an, fällt der Abgesang der Linken noch krasser aus: Hatte die MAS dort zuletzt nach den Wahlen von 2020 noch knapp eine Zweidrittelmehrheit verfehlt, bleiben nach heutigem Stand der Dinge noch fünf Sitze für die Alianza Popular und einer für die MAS. Doch auch für die Wahlsieger könnte es fraglich werden, ob sich eine Mehrheit ausgeht. Eine Rechtsallianz war vor den Wahlen gescheitert. Quiroga scherte aus, weil der in Umfragen besser platzierte Doria Medina Spitzenkandidat werden sollte. Letzterer hat bereits angekündigt, in der Stichwahl Paz zu unterstützen. Doch ob eine Allianz von Christdemokraten und Unidad hält und sichere Mehrheiten bringt? Solche wird man sich suchen müssen. Ob Stabilität das bisherige Chaos ablöst ist fraglich. Banzerismo durch die Hintertür? Alle drei stehen freilich für eine Rückkehr zum Neoliberalismus. Beziehungen zu Washington dürften schnell wieder angeknüpft werden. Dass es zu Umkehrungen des Prozesses des Wandels ( proceso de cambio ) kommt ist wahrscheinlich. Schon ist von Freilassung der „politischen Gefangenen“ die Rede. Der Zementunternehmer Samuel Doria Medina war bereits zu Beginn der 1990er Jahre Minister im Kabinett des Präsidenten Jaime Paz Zamora, dessen ursprünglich sozialdemokratisches Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) einen hohen Preis im Kampf gegen die Militärdiktaturen gezahlt hatte, dann aber doch mit dem Exdiktator Hugo Banzer koalierte und letztlich in Korruptionsskandalen versank. Er gilt als gemäßigt liberal. „Tuto“ Quiroga war ein knappes Jahrzehnt später nach Banzers Krebstod ein Jahr lang zum Präsident aufgerückt. Teil der damaligen Megakoalition waren auch die Christdemokraten. Hugo Banzer, Absolvent der US Army School of the Americas, hatte sich im August 1971 an die Macht geputscht und war bis Juli 1978 einer der blutigsten Militärdiktatoren. Im Juli 1997 wurde er demokratisch zum Präsidenten gewählt. Überraschungswahlsieger Rodrigo Paz Pereira wird als Newcomer gesehen. Seine Wahl ist Ausdruck des Überdrusses mit den politischen Dinosauriern sowie Misswirtschaft und Korruption, für die man die MAS verantwortlich macht. Die Umfragen vor den Wahlen hatten ihn gar nicht auf dem Radar. Zu Fernsehdebatten war er nicht eingeladen. Ohne nennenswerte Parteiinfrastruktur war er vielmehr persönlich durch das Land getourt. „Wir sind die Stimme derer, die bisher keine Stimme hatten“, sagte er bei einer spontanen Siegesfeier mit einer Handvoll seiner Anhänger auf der Hahnentreppe ( grados del gallo ), die in La Paz den Prado mit der Calle Mexico verbindet. Wie sein Vater Jaime Paz Zamora (Präsident von 1989 bis 1993), dessen Spitzname „ el gallo “ war, hat er einen Hahn als Symbol. Seine eigene Karriere hat er im Jahr 2002 als Abgeordneter in dessen MIR begonnen. Später war er Bürgermeister der Stadt Tarija (2015-2020) und zuletzt ab 2020 Senator für Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadano (CC). Wie gesagt: Seine Christdemokarten waren seinerzeit auch Teil von Hugo Banzers Megakoalition. Paz Pereira, der im September 58 Jahre alt wird, ist also durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Als Zugpferd und Sympathieträger gilt sein Vizepräsidentschaftskandidat Edman Lara, der sich bei der Polizei von Cochabamba als mutiger Korruptionsbekämpfer einen Namen gemacht hat und dort auch eine Degradierung dafür in Kauf nahm. Inwieweit Paz für einen Neuanfang stehen kann, bleibt abzuwarten. Doria Medina hat ihm bereits Unterstützung bei der Stichwahl zugesagt, und auch für Linke dürfte er eher wählbar sein als der Rechtsaußen Quiroga. Nullsummenspieler Sofern diese nicht auf den Altpräsidenten Evo Morales setzen, der nicht mehr kandidieren durfte und sich in seiner Bastion, dem Kokaanbaugebiet Chapare , von Anhängern protegiert verschanzt hat, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. (Wir berichteten.) In Bolivien herrscht Wahlpflicht. Morales hatte dazu aufgerufen, aus Protest ungültig zu wählen ( voto nulo ) und in der Tat liegen die ungültigen Stimmen mit 19,1 Prozent auf Platz 4. Er verfügt also durchaus noch über eine Anhängerschaft und ist täglich in den Medien präsent. Allerdings: Seine Aufrufe zu Märschen und Blockaden hatten zuletzt immer mehr an Zugkraft und Gefolgschaft verloren. Von den genannten 19,1 Prozent der Stimmen darf man getrost mindestens 5 Prozent üblicher Nullvoten abziehen; bei den äußerst politisierten Wahlen von 2020, die die MAS bei einer Rekordwahlbeteiligung von 88 Prozent mit 55,1 Prozent der Stimmen zur Abwahl der de facto-Regierung gewonnen hatte, waren es immerhin auch 3,5 Prozent Nullvoten. Bei einer Wahlbeteiligung von diesmal eher nur 77 Prozent und einer außergewöhnlich großen Unübersichtlichkeit angesichts eines beinahe unmerklichen Wahlkampfs sowie von last minute–Allianzen dürften es deutlich mehr sein, die damit nicht Morales’ Protestaufruf gefolgt sind. Bei Vorwahlumfragen waren die Unentschlossenen die größte Gruppe. Rechnet man die Stimmen der MAS mit jenen von Andrónico Rodríguez zusammen und schlägt hypothetische Morales - Proteststimmen von 10 Prozent dazu, so hätte eine MAS – Krise und Querelen hin oder her – durchaus noch eine Rolle spielen können. Doch der Morales-Schüler Andrónico Rodríguez wollte durchaus nicht mit den Anhängern des glücklosen Präsidenten Luis Arce (MAS) paktieren, der ihm sogar den Spitzenplatz freigeräumt hatte. Bis zur Stunde habe man das Wahlziel erreicht, die MAS-IPSP ( Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos ) vor der Auslöschung zu retten, erklärte der Spitzenkandidat Eduardo del Castillo. Mit nur 3,14 Prozent der Stimmen und nur einem Sitz in der Abgeordnetenkammer ein wahrlich bescheidener „Erfolg“ angesichts der Ergebnisse der letzten mehr als 20 Jahre. Selbst als die MAS im Jahr 2002 zum ersten Mal antrat wurde sie auf Anhieb zweitstärkste Kraft und gewann 8 von seinerzeit 27 Senatoren und 27 von 130 Abgeordneten. Del Castillo selbst wertet es als Resultat rücksichtsloser Egoismen – man könnte es auch einen kompletten Mangel an politischer Weitsicht und Verantwortungsgefühl bezeichnen. Immerhin schaut del Castillo nach vorne und lädt „desorientierte“ Abweichler dazu ein, in die Reihen der MAS zurückzukehren. Paz und Quiroga würden eine neoliberale Schocktherapie anwenden und die Krise für die einfachen Leute noch verschlimmern. Nach 20 Jahren habe die MAS sich verjüngt und die Kader mit Blick auf die nächsten 30 Jahre ausgetauscht. Im Unterschied zu den anderen Parteien, die seit 25 Jahren auf die gleichen Personen setzen. Zumindest Letzteres stimmt weithin. Hoffnungen auf einen Neuanfang im Jahr 201 nach der Unabhängigkeit von der Spanischen Krone bleiben bescheiden. Nachtrag 24.8. Amtliches Endresultat Stimmen PDC 32,06 Libre 26,70 Unidad 19,69 AP 8,51 MAS 3,17 Nulo 19,7 Sitze Diputados PDC 56 Libre 43 Unidad 22 AP 6 MAS 1 insg. 130 Senado PDC 16 Libre 12 Unidad 7 insg. 36 Auflistung unvollständig; eine Allianz zwischen PDC und Unidad hätte demnach in beiden Kammern eine Mehrheit.
„Wir werden nicht zulassen, dass wir wieder die Bösen sind“, sagte Laura Gil, die scheidende kolumbianische Botschafterin in Wien, die als Stellvertretende Generalsekretärin zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) geht. Kolumbien habe enorme Opfer im Kampf gegen den Drogenhandel gebracht. In der Tat berichtet der im Juni vom Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime ) mit Sitz in Wien veröffentlichte World Drug Report 2025 von einer Kokainschwemme, die vor allem auf eine abermalige Rekordproduktion in Kolumbien zurückgeht. Kokain sei der am schnellsten wachsende illegale Drogenmarkt, konstatiert das UNODC. Die Kokainproduktion liege mit geschätzten 3.708 Tonnen (Zahlen für 2023) um 34 Prozent höher als 2022. Was den Anbau des pflanzlichen Grundstoffs betrifft, die Blätter des Kokabusches, so entfallen auf Kolumbien 253.000 Hektar, auf Peru 92.784 und auf Bolivien 31.000. Und während er in Bolivien stabil und in Peru leicht zurückgegangen sei, nehme er in Kolumbien rapide zu – und nicht nur das. Verbesserte Sorten und Anbaumethoden sowie Innovationen bei der Weiterverarbeitung der Kokablätter bringen auch höhere Erträge. Während die Kokaanbaufläche dort um 10 Prozent angewachsen sei, rechnet man mit einem Anstieg der Kokainproduktion um 50 Prozent. Und so fürchtet man in Bogotá die alljährliche „certification“ durch den US-Präsidenten – auch wenn sie offiziell nicht mehr so heißt, denn dieser heißt nun Donald Trump. Imperiale Zertifizierung Gemäß dem bereits 1986 in der Amtszeit von Ronald Reagan verabschiedeten Anti-Drug-Abuse-Act muss der Präsident alljährlich überprüfen, ob sogenannte drogenproduzierende - oder Transitländer ihren drogenpolitischen Verpflichtungen nachgekommen sind und „kooperativ“ waren. Wenn nicht, werden automatisch eine Reihe von Sanktionen fällig, wie der Stopp von US-Hilfen, Handelssanktionen und US-Vertreter werden auch bei internationalen Organisationen wie der Weltbank gegen Kreditbewilligungen stimmen. Diese Sanktionen können wiederum ausgesetzt werden, wenn der Präsident erklärt, dass nationale Sicherheitsinteressen dies geraten erscheinen lassen. Für die betroffenen Länder ein beträchtliches Damoklesschwert, mit dem es Washington gelang, dort jeweils seine Sicht der Dinge und mitunter sehr konkrete Maßnahmen durchzusetzen. Nur Weltpolizist Uncle Sam verfügt (seit 1978) über ein Büro für internationale Drogenangelegenheiten und Gesetzesvollzug im Außenministerium, das unter anderem für eine permanente Überwachung sorgt. Im März dieses Jahres waren es Bolivien, Burma und Venezuela die, wie es heißt: „have demonstrably failed their obligations“. Doch noch unterzeichnete Präsident Biden das unter seiner Regierung entstandene Dokument, der ihnen bescheinigte, dass eine fortgesetzte Unterstützung „vital to the national interests of the United States“ sei.(1) Die „certification“ ist also keine Erfindung der Trump-Administration, passt aber als (un)diplomatische Anmaßung perfekt in deren imperiales Amerika-First-Weltbild. Schon die Auswahl der betroffenen Länder macht deutlich, dass es hier eben nicht primär um die Lösung drogenpolitischer Probleme geht: Bolivien ist mit weitem Rückstand nur der drittgrößte Kokaproduzent. Venezuela spielt eine Rolle beim Transit, aber vornehmlich nach Europa, nicht in die USA. Die Regierungen beider Länder sind Washington freilich ein Dorn im Auge. Desgleichen Brasilien, wo aktuell Richter und Staatsanwälte von den USA mit Sanktionen überzogen werden, die in Sachen der aktiven Beteiligung des Expräsidenten Jair Bolsonaro am Putschversuch gegen Wahlsieger Lula da Silva vom 8. Januar 2023 tätig sind. Und brasilianische Waren sind nun in USA mit 50-prozentigen Zöllen belegt. Da überrascht es nicht, wenn Außenminister Marco Rubio dem kolumbianischen Expräsidenten Álvaro Uribe (2002-2010) unverzüglich mit einer Richterschelte beispringt. Uribe, dem Verbindungen zu rechtsextremen Paramilitärs vorgeworfen werden, wurde soeben wegen Zeugenbeeinflussung verurteilt. Und die Verhängung von 50-prozentigen Zöllen auf Kupfer trifft vor allem die Linksregierung von Gabriel Boric in Chile, dem wichtigsten Kupferexporteur, die sich bei den im November bevorstehenden Wahlen einer wieder erstarkten extremen Rechten gegenüber sieht. Es geht hier um politischen Kulturkampf, nicht um die Lösung von Problemen. Tatsächliche Drogenprobleme Diese stellen gesundheitspolitische Herausforderungen und Probleme im Bereich der Organisierten Kriminalität dar. So beklagt der World Drug Report 2025 einen weiteren Anstieg der Drogenkonsumenten auf 316 Millionen (6 Prozent der Weltbevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren); davon 244 Cannabis-, 61 Opioid-, 30,7 Amphetamin-, 25 Kokain-, und 21 Millionen Ecstasykonsumenten. Die Gesamtzahl ist höher als 316 Millionen, weil häufig mehrere Substanzen konsumiert werden, was besonders riskant ist, wenn es gleichzeitig geschieht. Hier zeichnet sich aber eine positive Entwicklung ab. Der Cannabis-Konsum junger Menschen geht deutlich zurück. Das gelte unabhängig davon, ob strikte Prohibition herrsche oder liberalere Gesetze und sei auf gestiegenes Gesundheitsbewusstsein beziehungsweise Risikowahrnehmung zurückzuführen, hört man aus dem UNODC. Die Drogenberichte Deutschlands und Österreichs bestätigen dies und berichten Gleiches auch über den Alkoholkonsum, auch wenn konservative Politiker angesichts der neuen Cannabis-Gesetzgebung des vormaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach Zeter und Mordio schrien, noch bevor irgendwelche (belastbaren) Zahlen vorlagen und sogar den Kölner Bandenkrieg vom letzten Sommer damit in Verbindung brachten, wo es doch gerade darum geht, diesen Banden durch einen regulierten, legalen Markt den Boden zu entziehen. Die größten Gesundheitsprobleme liegen nach wie vor sehr eindeutig bei Opiaten und ihrer Verabreichung durch Spritzen sowie Opioiden. Laut UNODC sind Hepatitis C- und HIV-Infektionen für zwei Drittel der tödlich endenden Drogenkarrieren verantwortlich. Und in Nordamerika sterben alljährlich Zehntausende im Rahmen der „Fentanyl-Krise“ an Opioid-Überdosen. Gerade hier zeichnet sich auch für Europa ein Problem ab, das paradoxerweise mit dem bislang erfolgreichen Anbauverbot für Schlafmohn durch die Taliban in Afghanistan verbunden ist. Die Opiumproduktion, Ausgangsprodukt für Heroin, ist dort um 95 Prozent gesunken; weltweit sind es nur 72 Prozent, weil Myanmar (Burma) nun wieder mehr produziert. Bisher haben üppige Lagerbestände dafür gesorgt, dass die Angebotsverknappung auf den europäischen Märkten kaum zu spüren war. Sie dürften noch bis 2026 halten. Doch schon sind einerseits die Opiumpreise in Afghanistan um das Zehnfache gestiegen und es besteht andererseits die Gefahr, dass eine Verknappung dazu führt, dass das Endprodukt Heroin durch wesentlich potentere und gefährlichere Fentanyle oder Nitazene gestreckt oder ersetzt wird. Ein unkalkulierbares Risiko. Eine neue Ära globaler Instabilität habe die Herausforderungen im Kampf gegen das Drogenproblem intensiviert, Gruppen der Organisierten Kriminalität (OK) gestärkt und den Drogenkonsum auf Rekordniveau gehoben, schreibt die scheidende UNODC-Chefin Ghada Waly in ihrem Vorwort. Drogen sind weltweit die wichtigste Einkommensquelle für Gruppen der OK. Hier macht sich der World Drug Report 2025 Gedanken über ein gezieltes Vorgehen gegen solche Gruppen und deren Schlüsselpositionen und -figuren. Da geht es um dreistellige Milliardenbeträge, wenngleich Schätzungen schwierig sind. So gehe fast die Hälfte der Geldwäscheoperationen in Europa auf Drogengeschäfte zurück. Konventionelle Standardmaßnahmen hätten sich als wenig effizient erwiesen. Eine übergroße Anzahl von Verfahren betreffe Drogenbesitz und -konsum. Neue Töne aus Wien. Experten beklagen seit langem, dass überwiegend kleine Fische verfolgt werden. Gerade für lateinamerikanische Länder stellt die OK mit ihren Einnahmen aus dem expandierenden Kokaingeschäft ein besonderes Problem dar. Verschiedene ihrer Gruppen fordern dort nicht nur Rechtstaatlichkeit und Demokratie heraus, sie haben vielfach auch territoriale Kontrolle erlangt: etwa in brasilianischen Favelas oder ganzen Landstrichen Mexikos und Kolumbiens. So stellt das im Jahr 1993 in einem Gefängnis in São Paulo gegründete Primeiro Comando da Capital (PCC) in Brasilien, dem inzwischen zweitgrößten Konsumenten von Kokain nach den USA, laut US State Department die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Es sei dort in 22 der 27 Bundesstaaten aktiv sowie in 16 Ländern weltweit, darunter in den USA und im Nachbarland Bolivien. Im Mai 2024 hat man im Bundesstaat Amazonas 200 Meilen westlich von Manaus 2,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Kolumbien im Visier Warum also Kolumbien? Unter dem Etikett des Kampfes gegen den Drogenhandel und über den Hebel der „certification“ haben die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit auch strategische Interessen verfolgt, die die Trump-Administration gefährdet sieht. Zudem duldet sie keine Unbotmäßigkeiten. Mexiko, wo es neben Drogen vor allem um illegale Migration geht, wurde außerhalb des regulären Verfahrens bereits per Dekret die „certification“ entzogen. Gleich zu seinem Amtsantritt definierte Präsident Trump mexikanische Drogenorganisationen als Terrororganisationen und brachte Präsidentin Claudia Sheinbaum mit Interventionsdrohungen dazu, die Grenzkontrollen zu militarisieren. Mexiko ist für die USA der mit Abstand wichtigste Zulieferer von Opioiden wie Fentanyl und Transitland für Kokain. Kolumbien ist traditionell der wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten in Lateinamerika. Im Rahmen des noch unter Präsident Clinton initiierten Plan Colombia hat Washington dort seit der Jahrtausendwende 12,6 Milliarden USD in die Drogen- und Aufstandsbekämpfung gesteckt. Zwei Drittel davon waren Polizei- und Militärhilfe. Sieben Militärbasen entstanden, wo unter anderem kolumbianische Militärs von US Special Forces für den Drogenkampf ausgebildet wurden, die heute im Rahmen der Regional Security Cooperation ihrerseits Ausbildungsprogramme für Sicherheitskräfte anderer lateinamerikanischer Länder durchführen; im vergangenen Jahr sollen es 6.000 gewesen sein. Zumeist richteten die Regierungen in Bogotá ihre Politik nach den Wünschen Washingtons aus. Wo sie zu eigenwillig waren, half man nach. So führten Korruptionsvorwürfe und der Entzug der „certification“ dazu, dass Präsident Ernesto Samper Mitte der 1990er Jahre in ein Programm zur Besprühung von Kokafeldern mit Glyphosat aus der Luft einwilligte. Die Anbaufläche wuchs in den darauffolgenden Jahren trotzdem um das Dreifache. Waren es ursprünglich nur sechs, so wurde zur Jahrtausendwende in 23 der 33 Departments Koka angebaut. Seither will man mehr als 2,5 Millionen Hektar vernichtet haben – mehr als das Zehnfache der heutigen Rekordanbaufläche. Das Gegenteil einer nachhaltigen Strategie. Insbesondere in den Jahren der Seguridad Democrática unter Präsident Álvaro Uríbe wurde schwerpunktmäßig über Guerillagebiet im Süden des Landes gesprüht. Landesweite Kokareduzierungen um 80.000 Hektar zwischen 2000 und 2004 wurden fast ausschließlich in den südlichen Departments Caquetá und Putumayo erzielt, Hochburgen der Guerilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Diese Strategie, die Guerilla von ihrer wichtigsten Einkommensquelle abzuschneiden, hält man in Washington für ausschlaggebend dafür, dass die FARC schließlich zu Friedensgesprächen bereit waren. Zumindest ebenso wichtig dürfte aber der Einsatz von US-Militärtechnologie ( high value targeting ) gewesen sein, die es erlaubte, Guerillacamps unter dem Blätterdach aufzuspüren. Auf diese Weise konnten etliche ihrer Comandantes gezielt getötet oder gefangen genommen werden. Wie dem auch sei: Im Jahr 2015 wurden die Besprühungen im Rahmen des Friedensprozesses eingestellt, für den Präsident Juan Manuel Santos 2016 den Friedensnobelpreis erhielt. Der Bürgerkrieg mit der ältesten und größten Guerillaorganisation war zu Ende. Tausende ihrer Kämpfer wurden entwaffnet, Hunderte später ermordet. Denn Nachfolger Iván Duque – wie auch etwa die Hälfte der Wahlbevölkerung – hielt nichts vom Friedensabkommen. Insbesondere das Kapitel 4 des Abkommens, wonach die Bauern ihre Kokafelder freiwillig aufgeben und mit Überbrückungskompensationen auf Alternativen umsteigen sollten, hat nicht funktioniert. Nicht nur, weil es eine sehr schwierige Aufgabe gewesen wäre, sondern vor allem, weil es unter der Regierung Duque nicht umgesetzt wurde. Insgesamt ist es nicht gelungen, in den von der Guerilla geräumten Gebieten (rechts-)staatliche Präsenz herzustellen. „You’re going to have to spray“, richtete Donald Trump Iván Duque schon bei dessen Besuch in Washington im Jahr 2020 aus. Der hätte das auch gerne getan, nur wollte die Biden-Administration (ab 2021) diesen Irrsinn nicht mehr finanzieren. Denn nicht nur hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Pflanzengift Glyphosat in Verdacht, krebserregend zu sein. Die Politik der Zwangseradikation hatte sich längst überdeutlich als Nachhaltigkeitsdesaster mit hohen Nebenkosten wie Umweltschäden und Bauernvertreibung erwiesen. Die amtierende Regierung von Gustavo Petro setzte unter dem Motto Paz Total die Befriedungspolitik fort und dabei wieder auf Freiwilligkeit bei den Bauern und legte einen Schwerpunkt auf die Drogenhändler. Da wurden in den beiden vergangenen Jahren sowohl bei den Kokainbeschlagnahmungen (960 Tonnen im Jahr 2024) als auch bei der Entdeckung und Zerstörung von Drogenlabors Rekordergebnisse erzielt. Doch Kokaanbaufläche und Kokainproduktion wachsen weiter. Das Problem liegt heute nicht nur darin, dass Bauern einmal mehr von ihrer Regierung enttäuscht wurden und das Vertrauen verloren. Mit der Auflösung der FARC ist die Situation der territorialen Kontrolle noch komplizierter geworden. Die heutigen Hochproduktivitätszonen – paradoxerweise liegen sie gerade in den früheren Schwerpunktregionen der Guerillabekämpfung im Süden des Landes – befinden sich unter Kontrolle von Guerilla-Dissidenten, rechtsextremen Paramilitärs oder sonstiger bewaffneter Banden. Die Bauern werden dort manchmal sogar zum Anbau gezwungen. So sah sich die Regierung Gustavo Petro im vergangenen Jahr gezwungen 1.400 Polizei- und Militärkräfte in die Regionen El Plateado und Cañón de Micay im Department Cauca zu entsenden, wo es im März dieses Jahres zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit FARC-Dissidenten der Frente Carlos Patiño kam. Im Rahmen ihrer Nationalen Drogenpolitik von 2023 möchte sie bis 2026 40 Prozent der Kokaanbaufläche reduzieren und 50.000 Bauern in alternative Produktion bringen. Doch wurde bereits das bescheidene Eradikationsziel von 10.000 Hektar (2024: 9.403) knapp verfehlt. Retourkutsche? Mit der weiteren Schwerpunktverlagerung der Kokainproduktion in den Süden Kolumbiens wurde das Nachbarland Ecuador mit seinen Pazifikhäfen zum wichtigen Transitland und zum Schauplatz blutiger Revierkämpfe von Drogengangs. Die Rate von Mord und Totschlag kletterte dort von 7,8 (pro 100.000 Einwohnern) im Jahr 2020 auf 45,7 (2023). In Deutschland liegt sie bei 0,82, in Österreich bei 0,87. Ein Fanal war die Besetzung eines Fernsehstudios vor laufenden Kameras durch Angehörige der Bande Los Choneros und die Flucht von deren Chef José Adolfo Macías alias „Fito“ aus dem Gefängnis im Januar 2024, was zur Verhängung des Ausnahmezustands führte. Die Politik der harten Hand des im Frühjahr wiedergewählten ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa kann als Beispiel dafür gelten, was Washington gefällt. Nach seiner erneuten Verhaftung am 25. Juni 2025 wurde „Fito“ umgehend an die USA ausgeliefert. Im Gegensatz zu seiner Kollegin Claudia Sheinbaum in Mexiko, die einen Einsatz ausländischer Truppen auf ihrem Staatsgebiet ablehnt, bemüht sich Noboa darum, dass Washington ecuadorianische Gruppen ebenfalls als Terrororganisationen einstuft, was den Weg dafür frei machen würde. Bereits im Februar 2024 hat die ecuadorianische Regierung gemeinsame Operationen von US-Militärpersonal und ecuadorianischen Sicherheitskräften erlaubt. Bei seinem Besuch in den USA warb Noboa um US-Militärunterstützung und er verhandelte sogar mit dem privaten Söldnerunternehmen Blackwater , das ecuadorianische Sicherheitskräfte für den Straßenkampf ausbilden soll. Der Sender CNN berichtete darüber hinaus über sehr konkrete Pläne, die Luftwaffenbasis Manta wieder zu aktivieren und zum Marinestützpunkt auszubauen. Manta war zwischen 1999 und 2009 eine sogenannte Forward Operation Location – FOL des US Southern Command zur Luftraumüberwachung im Andenraum, bevor ausländische Militärbasen in der neuen Verfassung von 2008 verboten und der Stützpunkt unter Präsident Rafael Correa geschlossen wurde. Die Funktionen von Manta wurden damals teilweise von den erwähnten sieben Militärbasen in Kolumbien übernommen. Ganz anders stellt sich das Verhältnis der Trump-Administration zur kolumbianischen Regierung unter Gustavo Petro dar. Nicht nur steht man deren Politik des Paz Total skeptisch gegenüber (um das Wenigste zu sagen). Gleich zu Beginn von Donald Trumps Amtszeit gab es einen showdown in den Beziehungen, als Präsident Petro Flugzeuge mit abgeschobenen Flüchtlingen zurückwies und dann unter Sanktionsdrohungen zum Einlenken gezwungen wurde. Eine einmalige Brüskierung des wichtigsten Verbündeten. Schon im vergangenen Jahrzehnt war Kolumbien durch Unbotmäßigkeit aufgefallen, als es zusammen mit Mexiko und Guatemala eine Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen (UNGASS 2016) zur Drogenpolitik mit dem Ziel einer Reform erwirkte, was letztlich dann nur teilweise erfolgreich war. In diesem Frühjahr wurde bei der 68. UN Commission on Narcotic Drugs in Wien unter Federführung der eingangs zitierten kolumbianischen Botschafterin Laura Gil eine Resolution eingebracht, die eine Überprüfung des internationalen Regelwerks der Drogenkontrolle durch eine Expertengruppe verlangt. Die Resolution wurde mit 30 Stimmen, 18 Enthaltungen und drei Gegenstimmen angenommen, wozu ein verstörend arrogantes Eingangsstatement der US-Delegation beigetragen haben dürfte. Mit ihr stimmten nur Argentinien und Russland dagegen. Eine historische Abstimmungsniederlage für Washington in diesem Forum. Gerade vor diesem Hintergrund ist – abseits drogenpolitischer Probleme, Erfolge oder Misserfolge – eine „decertification“ als Retourkutsche denkbar. (1) U.S. Department of State/ Bureau for International Narcotics Matters and Law Enforcement Affairs: "International Narcotics Control Strategy Report", Vol. 1 Drugs and Chemical Control, Washington D.C., March 2025. Die zu Grunde liegende Bewertung erfolgt jeweils bereits im Herbst des Vorjahres. PS am 23.8.2025 Rückkehr zur „Militarisierung des Drogenkriegs“? Die sogenannte Militarisierung des Drogenkriegs oder Andenstrategie wurde im Gefolge der Anti-Drug-Abuse-Gesetzespakete von 1986 und 1988 ab 1989 unter George Bush (sen.) ausgearbeitet und am 25. Januar 1990 dem Kongress vorgelegt. Sie sah im Kern die Einbeziehung der jeweiligen Militärs in die Drogenbekämpfung vor. Die Bereitschaft der betroffenen Länder dazu wurde über die „certification“ hergestellt. Nach dreieinhalb Jahrzehnten kann man sagen, dass sie bei hohen Nebenkosten drogenpolitisch erfolglos war. Donald Trump geht nun einen Schritt weiter: Am 8. August meldete die New York Times, Präsident Trump habe eine Direktive an das Pentagon unterzeichnet, um mit Militäreinsätzen gegen jene lateinamerikanischen Drogenorganisationen zu beginnen, die seine Regierung als „terroristisch“ einstuft. Damit werden direkte Einsätze von U.S. Militärs auf fremdem Boden autorisiert. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum reagierte noch am selben Tag: „Die Vereinigten Staaten werden nicht mit ihrem Militär nach Mexiko kommen. (…) Wir kooperieren, wir arbeiten zusammen, aber es wird keine Intervention geben.“ Wenige Tage später berichteten auch europäische Medien, dass Washington die Entsendung mehrerer P-8-Aufklärungsflugzeuge, mindestens eines Kriegsschiffs und eines U-Boots in die südliche Karibik vorbereite. Die Trump-Administration hatte neben dem „Tren de Aragua“ auch das venezolanische „Cartel de los Soles“ – ein dubioses Netzwerk hoher Militärs, die in den Drogenhandel verwickelt sein sollen und über gute Verbindungen zur Regierung verfügen – zur Specially Designitated Global Terrorist (SDGT) erklärt und das Kopfgeld auf Präsident Maduro auf 50 Millionen US-Dollar erhöht. Dieser reagierte mit der Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären in seinem Land. Damit zeichnet sich in einer Region, in der übrigens auch Kuba liegt, eine gefährliche Eskalation ab.

Antonio Guterres muss sparen. Bei einem derzeitigen Haushalt von 3,26 Milliarden (Mrd.) € (3,7 Mrd. USD) will der UNO-Generalsekretär 15-20 Prozent einsparen. Allein im Sekretariat könnten 20 Prozent der Stellen wegfallen. Einzelne Unterorganisationen und Programme verfügen über gesonderte, oft erheblich höhere Budgets, doch auch sie sind von Kürzungen betroffen. Insgesamt könnten 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein. Besondere Gefahr besteht für Einzelorganisationen wie das Flüchtlings- und das Palästinenserhilfswerk (UNHCR und UNRWA), die in Washington besonders ungeliebt sind. Aus der Weltgesundheitsorganisation WHO sind die Vereinigten Staaten gerade wieder ausgetreten; aus der UNESCO (Erziehung, Wissenschaft und Kultur) und dem UNHCHR (Menschenrechte) sind sie unter Trump aus- und unter Biden wieder beigetreten. Dabei sind die Vereinten Nationen wegen notorisch überfälliger Beitragszahlungen ohnehin unter Druck. So waren die USA als wichtigster Geber zum 1.1.2025 mit 1,5 Mrd. USD in Verzug. Der inzwischen zweitwichtigste Geber, China, zahlt auch immer erst zum Jahresende. Angesichts der drängenden Probleme (Kriege, Konflikte, Klima) sind eine regelbasierte Weltordnung und multilaterales Handeln wichtiger denn je. Aber gerade sie sind ein Hindernis für Großmachtambitionen – und Reaktionären in ihrem Kulturkampf seit eh und je ein Dorn im Auge. Der Schweizer Unternehmer Christoph Blocher (Schweizerische Volkspartei) nannte die UNO in Ablehnung eines Beitritts (der dann 2002 doch erfolgte) bereits in den 1980er Jahren einen Hort des Kommunismus. Die USA, China und Russland haben den Internationalen Gerichtshof in Den Haag nie anerkannt und missachten seine Urteile, was nicht verwundert, verfolgen diese drei ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in ihrer Außenpolitik doch expansionistische Ziele. Ganzheitliche Analysen und Nachhaltigkeit Mit den 2015 verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungszielen (auch Agenda 2030) legen die Vereinten Nationen schon seit zehn Jahren mehr Wert auf ressortübergreifende Ansätze und Nachhaltigkeit. Soeben (20.5.2025) ist beim in Wien ansässigen Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ein Bericht erschienen: „ Minerals Crime: Illegal Gold Mining “, als Teil einer in Arbeit befindlichen Globalanalyse von Verbrechen, die die Umwelt schädigen. Bereits der World Drug Report 2023 hatte ein ganzes Kapitel 4 der Verschränkung krimineller Aktivitäten und der Umweltzerstörung in Amazonien gewidmet. (Wir berichteten an dieser Stelle: „Amazoniens Unterwelt“, 26. November 2024, robert-lessmann.com/amazoniens-unterwelt/) Gleich fünf UNO-Unterorganisationen erarbeiteten einen Bericht über Ernährungsunsicherheit in Lateinamerika und der Karibik, der bereits 2024 erschienen ist.* Demnach ist die Region nach Asien am meisten von der Klimakrise betroffen. Unmittelbare Folgen sind Extremwetterereignisse und sinkende landwirtschaftliche Produktivität. Soziale Ungleichheit komme als verschärfender Faktor hinzu. Im Jahr 2023 waren 41 Millionen Menschen in der Region von Hunger betroffen; eine besonders starke Zunahme sei in der Karibik festzustellen. 187,6 Millionen Personen leiden unter Ernährungsunsicherheit, eines von zehn Kindern unter fünf Jahren leidet an Mangelernährung. Paradoxerweise gehen Unterernährung und Übergewicht miteinander einher, sagt Karin Hulshof, die Regionaldirektorin von UNICEF für Lateinamerika und die Karibik. Das Recht von Frauen und Kindern auf Nahrung müsse bei allen Entscheidungen zur Klimapolitik Priorität haben, fordert sie. Im Jahr 2022 waren weltweit 5,6 Prozent der Kinder unter fünf Jahren von Übergewicht betroffen. In Lateinamerika waren es 8,6 Prozent. Die Hälfte der Bevölkerung in der Karibik könne sich keine gesunde und ausgewogene Ernährung leisten, in Mittelamerika seien es 26,3 Prozent und in Lateinamerika 26 Prozent. Laut FAO müsse die Landwirtschaft klimaresilienter werden, damit sie zunehmende Herausforderungen durch den Klimawandel und Extremwetterereignisse besser überstehen kann. Ein Bericht des UN-Weltentwicklungsprogramms (UNDP) vom Jänner 2025 analysiert ebenfalls Probleme durch den Klimawandel, geringe Produktivität, schwaches Wirtschaftswachstum, strukturelle Ungleichheit sowie Vertrauensverlust in Politik und Institutionen. Schon bald müsse man in vielen Ländern Lateinamerikas und der Karibik mit Wasserknappheit rechnen und bis zum Jahr 2080 mit einer schweren Wasserkrise. Das UNDP empfiehlt unter anderem Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Technologie. Politische Entscheidungen – zum Beispiel in Argentinien – gehen in eine andere Richtung. Von Seepferdchen und dem Kokain der Meere: Wildlife Crime Report 2024 Auch ein halbes Jahrhundert nach Inkrafttreten des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES, verabschiedet 1973; heute 184 Unterzeichnerstaaten) sind viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet oder vom Aussterben betroffen. Nur wenige Bereiche, wie Elfenbein und Nashorn, genießen globale Aufmerksamkeit. Andere Arten, wie akut vom Aussterben bedrohte Orchideen, werden kaum beachtet. In Südamerika liegen die gravierendsten Probleme im Bereich von Tropenhölzern, wie Großbeschlagnahmungen zeigen. Auch hier weist der Bericht auf gefährliche Verschränkungen verschiedener krimineller Sektoren hin, im konkreten Fall mit dem Drogenhandel und dem illegalen Goldabbau. Auch eine soziale Sensibilität greift Platz, die man sich in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Kokaanbau, auch längst gewünscht hätte. So sind Seepferdchen ein nicht zu unterschätzender illegaler Exportartikel Perus für Aquarien oder getrocknet (nach Asien, etwa Thailand oder die Philippinen). Peru ist übrigens die drittgrößte Fischereination nach China und Indonesien. Die Seepferdchen kommen meist tot oder sterbend als Beifang. Die Illegalität beginnt mit der Anlandung. Fischer sehen den Seepferdchen-Beifang als eine Art Bonus und wissen meist gar nicht, dass ihr Tun illegal ist. Sie wieder in die See zu werfen erscheint so sinnlos wie eine Bestrafung für das unabsichtliche Werk der kleinen Fischer. Illegal ist in Peru aber das Fischen mit Schleppnetzen innerhalb der Fünfmeilenzone, wo die meisten Seepferdchen hängen bleiben dürften. Gute Geschäfte machen Aufkäufer und Händler. Davon zeugen einzelne Beschlagnahmungen im Bereich von mehreren hundert Kilogramm. Im Jahr 2017 wurden 900 kg in Vietnam in einem Container aus Peru beschlagnahmt. Im September 2019 waren es 1.043 kg getrocknete Seepferdchen in einem Schiff vor der peruanischen Küste. Besonders kurios ist die Symbiose von Drogenexport und der illegalen Fischerei durch Mitglieder mexikanischer Drogenorganisationen. Ursprünglich ein willkommenes Zubrot beim Drogentransit, entdeckte man mit der Schwimmblase eines vom Aussterben bedrohten Fisches (Totoaba) das „Kokain der Meere.** Die Fischer erhalten dafür pro Kilo zwischen 500 und 3.000 USD. In China, wo sie in Suppen, in der traditionellen Medizin oder sogar als Wertanlage verwendet wird, kann man 80.000 USD erzielen. Washington isoliert Von einem Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Drogenpolitik spricht Ann Fordham, Direktorin der NGO International Drug Policy Consortium (IDPC): Mit 30 Stimmen, 18 Enthaltungen und drei Gegenstimmen (Argentinien, Russland und die USA) nahmen die Delegierten der 68. Commission on Narcotic Drugs (CND) des Wirtschafts- und Sozialrates der UN, die im März diesen Jahres in der Wiener UNO-City stattfand, eine unter Federführung Kolumbiens eingebrachte Resolution an, die die Einrichtung einer 19-köpfigen Expertengruppe vorsieht, um das Regelwerk der internationalen Drogenkontrolle zu überdenken und „to prepare a clear, specific, and actionable set of recommendations aimed at enhancing the implementation of the three drug conventions, as well as the obligation of all relevant international instruments, and the achievement of all international drug policy commitments.“ Zehn Mitglieder bestimmt die CND, fünf der Generalsekretär und drei das International Narcotics Control Board (INCB, der UN Suchtstoffkontrollrat zur Überwachung der Einhaltung der drei UN-Drogenkonventionen) und eines die Weltgesundheitsorganisation WHO. Dieser Beschluss reiht sich ein in eine Tendenz der allmählichen Öffnung der internationalen Drogenkontrolle, die ursprünglich fast vollständig von den USA dominiert war. So räumte die UN Sondergeneralversammlung zum Thema Drogen von 2016, bei deren Vorbereitung erstmals andere UN Unterorganisationen, wie die WHO oder das Hochkommissariat für Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Organisationen mitwirkten, größere „Interpretationsspielräume“ bei der Auslegung der drei UN Drogenkonventionen ein, um Desertionen vorzubeugen. NGO-Vertreterinnen machen nicht zuletzt ein „atemberaubend arrogantes Eingangsstatement“ und völlig unflexible Positionen ohne Verhandlungsbereitschaft der US-Delegation für das klare Votum der Delegierten verantwortlich. So wurden China, Kanada und Mexiko entgegen aller Gepflogenheiten direkt angegriffen und für die vielen Überdosis-Toten der US-Opioidkrise verantwortlich gemacht. Die kolumbianische Botschafterin Laura Gil in ihren Statement: „Alle Kolumbianerinnen und Kolumbianer verstehen und spüren, dass das globale Drogenproblem einen Schatten auf uns alle wirft, und dieses Forum ist eine Einladung, um unter dem Schirm der Konventionen das Prinzip der gemeinsamen und geteilten Verantwortung [für das Drogenproblem R.L.] jetzt und heute zu überdenken. Mein Land hat mehr Menschenleben geopfert als jedes andere in diesem Drogenkrieg, der uns aufgezwungen wurde. (…) Unsere besten Männer und Frauen und ein Löwenanteil unseres Budgets gingen in die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels. Wir brauchen neue und effektivere Mittel um ein globales System zu verwirklichen. Weiter zu machen wie bisher wird zu nichts führen.“ Ob diese Resolution tatsächlich einen Wendepunkt darstellen wird, muss ihre Umsetzung zeigen. Diese könnte, wie andere vielversprechende Ansätze, finanziellen Strangulierungen zum Opfer fallen. Laura Gil, die treibende Kraft dahinter, wurde am 5. Mai zur Stellvertretenden Generalsekretärin der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) gewählt und wird Wien verlassen. In der UNO-City kursieren Gerüchte und Spekulationen darüber, wie es mit den verschiedenen Unterorganisationen, wie etwa dem UNODC, weiter gehen könnte. Bei aller berechtigten Kritik an den Schwächen der Vereinten Nationen: Sie sind nur so stark wie ihre Mitgliedsländer es zulassen. Das Geschäft jener zu betreiben, die sie ohnehin schwächen oder abschaffen wollen, wäre abenteuerlich. * Food and Agriculture Organization (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Organisación Panamericana de Salud (OPS), Programa Mundial de Alimentos (WFP) und UNICEF: „El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024“ ** Neben dem erwähnten UNODC-Bericht auch: Israel Alvarado Martínez and Aitor Ibáñez Alonso: „Mexican Organized Crime and the Illegal Trade in Totoaba Maw“ in: Organized Crime 24, No. 4, 1st Dec. 2021 (https://doi.org/10.1007/s12117-021-09436-9)
Das hatte sich der wohl erfolgreichste Präsident, den Bolivien je hatte, anders vorgestellt. Das kleine Land im Herzen des Halbkontinents war nach seinem Erdrutschsieg Ende 2005 vielbeachteter Hoffnungsträger. Könnte die Entwicklung dort ein Vorbild sein? Nichts weniger als die „Neugründung Boliviens“ hatte man sich vorgenommen. Eine Regierung der sozialen Bewegungen wollte man sein. Bereits sechs Wochen nach Amtsantritt wurde ein Einberufungsgesetz zu einer verfassunggebenden Versammlung verabschiedet. Die neue Verfassung wurde dann 2009 – erstmals durch eine Volksabstimmung – angenommen. Bolivien wurde durch sie zum „plurinationalen Staat“. Soziale Rechte, Indígena-Rechte und die Rechte der Pachamama wurden darin festgeschrieben. Indigene Sprachen wurden auch Amtssprachen und die bunte Wiphala-Fahne gleichwertig neben die rot-gelb-grüne Nationalflagge gestellt. Die Nationalisierung der Kohlenwasserstoffressourcen vom 1. Mai 2006 spülte bei günstiger Konjunktur Devisen in die Staatskasse, die für eine Umverteilungs- und Sozialpolitik verwendet wurden. Die Armutsquote sank deutlich, die durchschnittliche Lebenserwartung stieg um Jahre. Ein bedeutender Teil der Unterschicht stieg in die untere Mittelschicht auf. Deren Binnennachfrage stabilisierte die Wirtschaft, auch als die Exporteinnahmen nach 2015 einbrachen. Grundlage war der Extraktivismus, insbesondere die Exporte von Erdgas. Grundlegende Strukturreformen unterblieben. Die Präsidentschaft von Morales war von einer Serie von Wahlen und Abstimmungen begleitet, was manche Beobachter als referenditis bezeichneten. Er hat sie alle mit absoluter Mehrheit gewonnen: eine bis dato in Bolivien unbekannte politische Stabilität. Nur nicht die beiden letzten... Heute sitzt Morales im Trópico de Cochabamba ohne Kandidatenstatus, ohne Partei, von einem harten Kern seiner Getreuen beschützt. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Sex mit Minderjährigen und Menschenhandel. Wie kam es dazu? Morales’ Fall Schon in seiner Zeit als Gewerkschaftsführer hat Morales Widersacher und Gegenkandidaten erfolgreich ausgeschaltet. Als Präsident wechselte er seine Minister in rascher Reihenfolge, servierte unter anderem seinen Mentor und Lehrmeister ab, den großen alten Gewerkschafter Filemón Escobar, und war sehr erfolgreich darin, die wichtigsten der vielen sozialen Bewegungen zu bedienen, die seine Regierung unterstützten. Die neue Verfassung vom Januar 2009 sieht in Art. 168 nur zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden vor. Ein Referendum zur Änderung dieses Artikels ging im Februar 2016 knapp verloren. Mitentscheidend waren damals Berichte eines „Enthüllungsjournalisten“ über ein gemeinsames außereheliches Kind des Präsidenten mit einer stets grell geschminkten Blondine, was dieser abstritt. Bilder von gemeinsamen Auftritten – etwa beim Karneval von Oruro – belegten demgegenüber zumindest eine gewisse Verbindung zwischen beiden und später wurde die Dame zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie hatte in dieser Zeit millionenschwere Regierungsaufträge für die chinesische Firma an Land gezogen, für die sie arbeitete. Der Ruf war angekratzt, doch wurden keine Spuren eines angeblichen Kindes gefunden. Politisch schlimmer wog, dass Morales das Ergebnis dieses Votums ignorierte und bei den Wahlen vom Oktober 2019 erneut kandidierte, was seinen Ruf als Demokrat nachhaltig beschädigte. Seine Popularität sank. Für die Opposition war klar: Es würde Wahlbetrug geben, das Regierungslager sah einen Putsch voraus. Die Wahlen brachten dann herbe Verluste von wahrscheinlich 14 Prozent, doch Morales gewann sie noch immer mit etwa 47 Prozent. Fraglich blieb, ob er 10 Prozentpunkte vor dem stärksten Oppositionskandidaten lag, wodurch eine Stichwahl vermieden würde. Als in der Wahlnacht die Schnellauszählung (nicht die amtliche!) angehalten wurde, nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Sechs von neun Departments-Wahlzentralen gingen in Flammen auf. Straßenproteste wurden wenige Tage später durch eine Polizeimeuterei befeuert. Schließlich legte der Armeechef Morales den Rücktritt nahe. Präsident und Vizepräsident gingen erst ins mexikanische Exil, dann nach Buenos Aires. Dorthin – so die heutige Anklage – sollen Morales immer wieder junge Mädchen zugeführt worden sein. Mit einer seinerzeit Fünfzehnjährigen soll er eine Tochter haben. Es war Hybris der Macht, mit der sich Morales selbst ins Abseits manövrierte. In Bolivien übernahm eine De-facto-Regierung, die von der politischen Rechten getragen wurde, von Korruption gekennzeichnet war und ohne Umschweife versuchte, den Prozess des Wandels, der seit 2006 stattgefunden hatte, rückgängig zu machen. Sie scheiterte an den Herausforderungen der Corona-Pandemie und politischen Ambitionen der Beteiligten. So wurde der Zweitplatzierte bei der Wahl von 2019, Carlos D. Mesa, praktisch ausgeschaltet. Vor allem aber erzwangen die machtvollen sozialen Bewegungen, die die MAS-Regierung stets getragen hatten, durch Straßenblockaden Neuwahlen, die dann im November 2021 die MAS mit 55,1 Prozent eindrucksvoll zurück an die Macht brachten. Vom argentinischen Exil aus hatte Morales seinen langjährigen Superminister für Wirtschaft und Finanzen, Luis Arce, als Spitzenkandidaten nominiert und seinen Intimfeind David Choquehuanca als Kandidat für die Vizepräsidentschaft. Der langjährige Außenminister hatte sich nach dem verlorenen Referendum vom Februar 2016 als Kandidat ins Spiel gebracht und war von Morales daraufhin auf einen Diplomatenposten ins „Exil“ befördert worden. Die Parteibasis hatte zuvor für Choquehuanca und Andrónico Rodríguez als Vize votiert, einen jungen politischen Ziehsohn Morales’. Nach dem Amtsantritt der Regierung Arce/ Choquehuanca kehrte Morales, vom argentinischen Präsidenten Alberto Fernández bis an die Grenze begleitet, im Triumphzug nach Bolivien zurück und versuchte sogleich, als Parteichef und Übervater weiterhin die Regierung zu lenken. Das konnte nicht gutgehen. Schon die Regionalwahlen von Anfang 2021 wurden – obzwar deutlich gewonnen – zum relativen Misserfolg. Es reüssierten oftmals Kandidaten und Kandidatinnen, die von Morales ausgebremst worden waren. Der jungen Eva Copa, die als Senatspräsidentin das Fähnlein der MAS gegen die De-facto-Regierung hochgehalten hatte während die Parteispitze im sicheren Exil saß, wurde vorgeworfen, mit der Regierung kooperiert zu haben. Eine Nominierung wurde ihr verwehrt. Sie wurde dann auf einer indigenistischen Liste mit 70 Prozent zur Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt, El Alto, gewählt. Stichwahlen gingen verloren und wurden teilweise durch MAS-Dissidenten gewonnen. Die MAS-internen Spannungen nahmen zu und regelmäßig wurden Präsident und Vizepräsident oder einzelne Minister von den sozialen Bewegungen zum Rapport einbestellt, die damals noch hinter Morales standen. Währenddessen versuchte die Opposition von ihrer Hochburg Santa Cruz aus fortlaufend, die Regierung durch „Bürgerstreiks“ zu destabilisieren, was das Land in Summe Milliarden kostete. Unter anderem war man gegen so triviale Dinge wie eine Volkszählung. Ein Fanal war die Aufforderung von Morales an „seine Regierung“ endlich in Sachen Volkszählung zu handeln – und zwar mit den Argumenten der Opposition. In dem Maße, wie die Kritik am Expräsidenten wuchs, der aus dem sicheren Exil heraus jene kritisiert hatte, die daheim für ihn den Kopf hingehalten hatten, wurde Morales’ Kritik an „seiner“ Regierung immer direkter und schriller. Morales warf ihr einen Rechtsruck und Paktieren mit der Opposition vor, nachdem man sich auf ein Verfahren zur Volkszählung geeinigt hatte. Zwölf Abgeordnete wurden aus der Partei ausgeschlossen, jegliche Kritik als „Verrat“ diffamiert. Als sich der junge Innenminister Eduardo del Castillo im Jänner 2022 „erdreistete“, Maximiliano Dávila zu verhaften, der unter Morales Chef der Spezialkräfte für den Kampf gegen den Drogenhandel gewesen war, nun aber von der DEA gesucht wurde und sich auf der Flucht nach Argentinien befand, wurde er neben Vizepräsident Choquehuanca und zusammen mit dem Justizminister zum Lieblingsfeind. Morales sprach von einem sinistren Plan gegen ihn und verlangte immer wieder deren Rücktritt. Man beschuldigte sich gegenseitig, mit dem Drogengeschäft unter einer Decke zu stecken. Als die MAS-Parlamentsfraktion zusammen mit der Opposition ein Amtsenthebungsverfahren gegen del Castillo durchsetzte, wurde er von Präsident Arce umgehend wieder berufen. Schließlich hatte er sich nicht nur aktiv gegen die Machtergreifung der Rechten 2019 gewehrt. Er hatte zusammen mit dem Justizminister auch dafür gesorgt, dass die maßgeblich Verantwortlichen vor Gericht gestellt wurden, darunter eine ganze Reihe hoher Militärs. Selbstdemontage der MAS Im Oktober 2023 war das Band zerrissen. Es gab bereits zwei MAS-Parlamentsfraktionen und auch die sozialen Bewegungen waren in „evistas“ und „arcistas“ gespalten. Morales berief einen Parteitag in seiner Hochburg im Kokaanbaugebiet des Tropico de Cochabamba ein, wo sich der lider indiscutible zwei Jahre vor den Wahlen zum Parteichef wiederwählen und vorzeitig zum Spitzenkandidat küren ließ. Dass Arce und Choquehuanca nicht kamen wurde als „Selbstausschluss“ gewertet. Freilich wurde der Parteitag als solcher wegen Verfahrensfehlern bei der Einberufung vom Wahlgerichtshof nicht anerkannt. Der Oberste Gerichtshof untersagte Morales schließlich mit einer abenteuerlichen Auslegung der Verfassung überhaupt die Kandidatur, weil er schon zweimal Präsident war. Diese spricht freilich für diesen Fall wie gesagt von aufeinanderfolgenden Amtsperioden. Die „evistas“ erkennen das Urteil nicht an, weil die Amtszeit der Richter bereits abgelaufen war. Eine Neuwahl der Verfassungsrichter war wegen der Pattsituation im Parlament nicht möglich gewesen. Im Mai 2024 wählten die „arcistas“ auf „ihrem“ Parteitag in El Alto mit Unterstützung des ihnen nahe stehenden „Einheitspakts“ der sozialen Organisationen den Bauerngewerkschafter (CSUTCB) Grover García zum Parteichef der MAS. Die „evistas“ protestierten dagegen mit Märschen und Straßenblockaden, die teilweise gewalttätig verliefen und sukzessive an Zulauf verloren. Auch sie dürften Milliardenschäden für die Volkswirtschaft verursacht haben. Präsident Arce hielt sich derweil vornehm zurück: Es sei die Zeit zu arbeiten. Für eine Kandidatenwahl sei es zu früh, gab er den fleißigen Administrator. Ein Volkstribun ist er ohnehin nicht. Dafür verfügt er als Präsident über die Mittel, seine Gefolgschaft bei der Stange zu halten. Woher Morales sie nimmt, ist nicht bekannt. Dabei steckt Bolivien in einer ernsten Wirtschaftskrise. Dollars sind knapp. Zeitweise muss händeringend Diesel importiert werden und die Lähmung des Transportsektors befeuert die Inflation. Ersatzinvestitionen wurden lange vernachlässigt. Die Regierung gibt die Schuld der Blockade der „evistas“, die im Parlament zusammen mit der Opposition Gesetze und Kreditbewilligungen blockierten. Die Devisenreserven fallen schon seit 2015 und liegen mit 1,9 Mrd. US-Dollars (USD; entspricht 4 Prozent des PIB) auf dem niedrigsten Stand seit 2005. Ein Bericht der UN Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) listet Bolivien unter den Ländern mit dem niedrigsten Wachstum und der höchsten Inflation auf. Präsident Arce wurde in der öffentlichen Wahrnehmung vom Architekten des bolivianischen Wirtschaftswunders zum Versager. In Umfragen liegt er bei 5 Prozent, während Morales immerhin noch rund 20 Prozent zugeschrieben werden. Ein bolivianischer Elon Musk? Was diese Umfragen wert sind, ist die Frage. Am meisten Aufmerksamkeit genossen jene, die von Marcelo Claure in Auftrag gegeben wurden, einem Selfmade-Unternehmer und Besitzer von Fußballclubs in Bolivien und den Vereinigten Staaten. Er strebe selbst kein Regierungsamt an, sagt er, wolle aber gerne helfen, Bolivien aus der Krise zu führen. Hauptsache, die Herrschaft der MAS ende. Aber Andrónico wäre noch immer besser als ein Pädophiler (Morales) oder ein Unfähiger (Arce): „Andrónico es mil veces mejor que un pedófilo o un incapaz y tengo mucha fé que todos trabajaremos juntos para sacar a Bolivia de este hueco“. Seine politische Präferenz liegt rechts der Mitte. Dort tritt eine Reihe von Altpolitikern an. Manfred Reyes Villa, 2021 mit 59 Prozent erneut zum Bürgermeister von Cochabamba gewählt, kommt ursprünglich aus dem Umfeld der ADN von Exdiktator Hugo Banzer. Er gilt als ebenso effizienter wie korrupter Administrator. Nach der Machtübernahme der MAS 2006 musste er mit einem halben Dutzend Korruptionsverfahren im Gepäck außer Landes fliehen. Daneben scheint eine Rechtsallianz, die hauptsächlich aus Drahtziehern der 2019 eingesetzten „Interimsregierung“ bestand, mit dem Ausscheiden von „Tuto“ Quiroga zerbrochen. Ihr wurden rund 20 Prozent prognostiziert. Quiroga war nach dem Krebstod von Hugo Banzer als dessen Vize von August 2001 bis August 2002 schon einmal zum Präsident aufgerückt. Er gilt als Schlüsselfigur jener illustren Runde, die nach der Flucht von Morales 2019 in der Universidad la Católica die Strippen für die Einsetzung der „Interimsregierung“ zog. Frontmann ist nunmehr der Zementunternehmer Samuel Doria Medina, der bereits 1992 unter dem sozialdemokratischen Präsidenten Jaime Paz Zamora einmal Planungsminister war. Er gilt als liberal-gemäßigt. Ebenso wie Carlos D. Mesa der Zweitplatzierte bei den Wahlen vom Oktober 2019, vormals ein honoriger Journalist und Historiker, der jedoch wegen seiner Rolle bei den Novemberereignissen von 2019 als „verbrannt“ gilt. Mit von der Partie ist aus dem Gefängnis Chonchocoro heraus auch Fernando Camacho, Organisator der Blockadeaktionen von Santa Cruz gegen die Regierung Arce, der sich damit brüstet, dass sein Vater 2019 die Polizei geschmiert und zur Rebellion angestiftet hat. Er wurde deshalb am 28. Dezember 2022 verhaftet. Im Umfeld der Überreste der seinerzeit von Hugo Banzer gegründeten ADN geistert ferner der notorische Speiseöltycoon Branco Marincovic herum, der bereits beim Zivilputsch von Santa Cruz 2008 die Fäden zog. Bolivien hat eine sehr junge Bevölkerung. Viele Wählerinnen und Wähler sind unter 30 Jahre alt und dürften sich kaum noch an die erfolgreichen ersten Jahre der Morales - Regierung erinnern, geschweige denn an das voraus gegangene Chaos und die damit verbundenen politischen Dinosaurier. Eine wichtige Rolle dürfte die Präsenz in den sozialen Medien spielen. Der Faktor Andrónico Politologen sprechen von einem dysfunktionalen Parteiensystem. Die einzige Partei mit nationaler Reichweite und Verankerung ist die MAS – und selbst die hatte vor den Regionalwahlen 2021 Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden. Die Finanzierung ist ein großes Problem. Man ist in einer Partei, weil man im Falle ihres Wahlsiegs auf einträgliche Posten hofft. Umgekehrt suchen sich Persönlichkeiten eingetragene Wahlkürzel, die sich mitunter sogar in Familienbesitz befinden und vermietet werden. Morales etwa ist aktuell verzweifelt auf der Suche nach so einer "Taxipartei". Ferner will er mit einem Marsch auf La Paz seine Kandidatur erzwingen. Ebenfalls auf der Suche nach einer „politischen Heimat“ ist Andrónico Rodríguez. Der 36-jährige Senatspräsident stammt aus Morales’ Kernland im Trópico und wurde von ihm als potenzieller Nachfolger aufgebaut. Lange führte er im Parlament die Fraktion der „evistas“ an, war dabei aber eher moderat und besonnen. Nach langem Zögern ist er nun vielfachen Rufen nach einer politischen Frischzellenkur nachgekommen und hat erklärt, dass er kandidieren wolle. Die „evistas“ sprachen umgehend von Verrat. Er steht für eine Fortführung des proceso de cambio und der bäuerlich-plebejischen Orientierung, kommt mit seiner Dialogbereitschaft aber auch bei den städtischen Intellektuellen an. Nun sucht der erklärte Kandidat nach einer Partei. Noch ist nicht abzusehen, wohin die Reise geht. In Frage kommen das Movimiento Tercer Sistema von Felix Patzi, der einmal Bildungsminister unter Morales war und gefeuert wurde oder das Movimiento de la Renovación Nacional der Bürgermeisterin Eva Copa, denen er erst Statur geben könnte. Oder ist Andrónico die letzte Chance für die MAS? Die hatte nach der Kandidatur von Andrónico Rodríguez einen Parteitag, auf dem Luis Arce zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben und Präsident Arce erklärte daraufhin, er würde nicht kandidieren und forderte Morales auf, es ihm gleich zutun. Beides vergeblich: Rodríguez wollte nicht für die "arcistas" kandidieren. Nachtrag (26.5.) nach Registrierungsschluss Der Nationale Wahlgerichtshof gab nunmehr folgende Kandidatenlisten bekannt: Nueva Generación Patriótica (NGP): Präsidentschaftskandidat Jaime Dunn mit Vizepräsidentschaftskandidat Édgar Uriona Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rodrígo Paz mit Edman Lara Frente Izquierda Revolucionaria (FIR) y Demócratas: Jorge Quiroga mit Juan Pablo Velazco Unidad Nacional (UN) y Creemos : Samuel Doria Medina mit José Luis Lupo APB – Sumate : Manfred Reyes Villa mit Juan Carlos Medrano Libertad y Progreso/ ADN : Paulo Folster mit Antonio Saravia Fuerza del Pueblo : Jhonny Fernandez mit Felípe Quispe Aus der (noch) Regierungspartei MAS gingen letztlich drei Listen hervor: Movimiento al Socialismo (MAS): Eduardo del Castillo und Milán Berna (aus der Bauerngewerkschaft CSUTCB) Movimiento de Renovación Nacional (MORENA): Eva Copa mit Jorge Richter (vormals Regierungssprecher von Präsident Arce) Alianza Popular/ MTS : Andrónico Rodríguez mit Mariana Prado (von 2017-2019 Planungsministerin unter Morales; gegenwärtig läuft noch ein Verfahren, ob das Movimiento Tercer Sistema von Felix Patzi die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt) Evo Morales hat seine ehemalige Ministerin für Kultur und Tourismus (2017-2019), Wilma Alanoca, als Vizepräsidentschaftskandidatin vorgesehen und kämpft mit einem für heute (26.5.) angekündigten Marsch auf La Paz weiterhin um nachträgliche Zulassung.

Beim Thema Migration haben die Trump-Dekrete bereits Verzweiflung ausgelöst. Als „scary“ (erschreckend oder beängstigend) beschreibt unsere Kollegin Coletta Youngers, die bis vor Kurzem jahrzehntelang für das Washington Office on Latin America (WOLA) gearbeitet hat, die Atmosphäre seit der Amtseinführung des 47. Präsidenten. In ihrem Stadtviertel wohnen viele Migranten, die sich fragen, was mit den angekündigten Razzien auf sie zukommt. Beängstigend ist auch die umgehende Begnadigung der Teilnehmer des Sturmes auf das Kapitol, knapp 1.600 Angeklagte beziehungsweise Verurteilte, darunter Führer und Mitglieder der paramilitärischen und rechtsradikalen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“, die wegen schwerer bis schwerster Delikte vor Gericht kamen, zum Beispiel Enrique Tarrio, Vorsitzender der „Proud Boys“, der wegen Verschwörung zu 22 Jahren Haft verurteilt worden war. Die nachträgliche Legitimierung eines Putschversuchs durch den Anstifter? Seinerseits scheinbar legitimiert durch das aktuelle Wahlergebnis, was die Sache eher schlimmer macht als besser. Beängstigend auch der sofortige Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein klares Bekenntnis gegen den Multilateralismus in einer Zeit multipler Krisen. „America First“, bedeutet das für Lateinamerika die Rückkehr zur Monroe-Doktrin, wonach der Halbkontinent exklusives Einflussgebiet oder Hinterhof der Vereinigten Staaten sind? Jedenfalls wird Lateinamerika an Aufmerksamkeit gewinnen. Zuletzt spielte der Halbkontinent im Süden eine eher geringe Rolle in der US-Außenpolitik, die dort auf Krisen wie Migration und Drogen bezogen war und sich sonst um andere Regionen kümmerte. Während in der ersten Amtszeit Trumps wichtige Posten, wie der des zuständigen Undersecretary for Western Hemispheric Affairs im State Department, monatelang unbesetzt blieb, legen das schon die Personalentscheidungen nahe. Außenminister wird mit Marco Rubio ein exilkubanischer Hardliner, sein Stellvertreter wird Christopher Landau, der Botschafter in Mexiko war. Schon im Vorfeld wurden Mitarbeiter des State Departments ausgetauscht und durch Getreue ersetzt. Nicht zuletzt wurden eine Reihe von Botschaftsposten in lateinamerikanischen Staaten umbesetzt. Mit Mauricio Claver-Carone wurde ein weiterer Exilkubaner, Hardliner und Sanktionsbefürworter Sonderbeauftragter für Lateinamerika. Schon während seiner ersten Amtszeit war Trump dafür bekannt, unterschiedliche Positionen gegeneinander auszuspielen. Sondergesandter – unter anderem für Venezuela – wurde mit Richard Grenell ein weiterer bekannter Hardliner, vormals Botschafter in Berlin, doch er ist mehr „Freihändler“ als Sanktionsbefürworter. Zentrale Themen dürften neben Migration und Drogen nun auch der Kampf um Rohstoffe und gegen die chinesische Dominanz sein. Hier kommt der omnipräsente Elon Musk ins Spiel, der als Autobauer direkte Interessen am Lithium-Dreieck (Argentinien, Bolivien, Chile) hat. Im WOLA erwartet man insgesamt deutliche Rückschritte bei demokratischen Normen, Räumen für die Zivilgesellschaft, dem Schutz der Minderheitenrechte, der Unabhängigkeit der Justiz, bei Initiativen für Inklusion und Vielfalt, Minderheitenrechten und beim Klimaschutz. Die Nähe zu autoritären Führern, wie Javier Milei (Argentinien), Nayib Bukele (El Salvador) oder der Bolsonaro-Familie könnte anti-demokratische Elemente in der Region beflügeln und demokratische Institutionen, bürgerliche Freiheiten und Sicherheiten sowie den Schutz der Menschenrechte in Frage stellen. Ein Sohn Bolsonaros gilt als Schlüsselfigur für die Vernetzung der lateinamerikanischen mit der internationalen Rechten und Jair Bolsonaro rief seine Anhänger zu Massendemonstrationen gegen die Einschränkungen für Musks Plattform X auf. Zur Amtseinführung konnte er nicht kommen. Wegen laufender Verfahren ist er mit einem Ausreiseverbot aus Brasilien belegt. Thema Migration Die Bekämpfung der Migration war und ist ein Trump’sches Kernthema. Er sieht sie gerne als gezielten Versuch (von wem eigentlich?) die Vereinigten Staaten zu schwächen. Migranten bezeichnet er als Terroristen, Vergewaltiger, Gesindel, Verbrecher und drohte mit der größten Abschiebungswelle, die die Welt gesehen hat. Dadurch werden vor allem Mexiko und die mittelamerikanischen Länder unter massiven Druck geraten und die Beziehungen belastet. Unter Androhung von Strafzöllen durchgesetzte Zwangsabschiebungen in Rambo-Manier gaben einen Vorgeschmack. Auch unter Biden war die Migrationspolitik restriktiv, aber durch bestimmte Schutzmechanismen – Temporary Protection Status etwa für Kinder oder Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela – abgemildert. Nun sollen flächendeckende Razzien, auch in Spitälern und Kirchen, sowie Massendeportationen durchgeführt werden. Grenzkontrollen sollen weiter militarisiert und Grenzbefestigungen ausgebaut werden. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat angekündigt, ihre Landsleute schützen zu wollen, etwa durch Rechtsbeistand über die Konsulate. Von den angedrohten Abschiebevorhaben sind potenziell vier Millionen Menschen aus Mexiko betroffen, zwei Millionen aus Mittelamerika, mehr als 800.000 aus Südamerika und 400.000 aus der Karibik. Rhetorischer Theaterdonner und Symbolpolitik also? Jenseits des dafür bewusst in Kauf genommenen menschlichen Leids und persönlicher Katastrophen: Weder für die abschiebenden Behörden noch für die Länder, die sie aufnehmen sollen dürfte das überhaupt auch nur annähernd zu leisten sein. Mehr noch: Nicht nur für Kuba, für eine ganze Reihe krisengeplagter Volkswirtschaften sind Familienüberweisungen der wichtigste oder zumindest ein wichtiger Devisenbringer. In Guatemala, Honduras und El Salvador entsprechen sie jeweils etwa einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Thema Drogen In der puritanistischen Einwanderergesellschaft waren „Drogen“ stets als besonders gravierendes und meist als von Außen in den „gesunden Gesellschaftskörper“ hereingetragenes Problem wahrgenommen worden. Die USA waren es auch, die mit der Haager Konvention von 1912 das erste internationale Drogenabkommen überhaupt forciert hatten. Seitdem Präsident Richard Nixon den Drogen im Jahr 1972 „den Krieg“ erklärte, war es über Parteigrenzen hinweg ein politisches Tabu soft on drugs zu erscheinen. Während der Präsidentschaft von Ronald Reagan kamen in den 1980er Jahren die südamerikanischen Produzentenländer von Kokain in den Focus, das als Hauptproblem angesehen wurde. Going to the source hieß die Devise. Während innenpolitisch in den letzten Jahren stärker differenziert und mehr Gewicht auf gesundheitspolitische Ansätze gelegt wurde, hat sich bei der Externalisierung der Drogenpolitik wenig geändert. Nur Weltpolizist Uncle Sam verfügt seit 1978 über ein Büro für internationale Drogen- und Gesetzesvollzugsangelegenheiten im Außenministerium, dessen Budget stets erheblich über dem des entsprechenden Pendants bei den Vereinten Nationen (UNDCP) liegt; hinzu kommen einschlägige Budgets, etwa im Pentagon.* Doch der jahrzehntelange, teilweise militarisierte Drogenkrieg ist bei hohen sozialen und ökologischen Kosten gescheitert. Die Produktion von Kokain (Bolivien, Kolumbien, Peru) ist auf Rekordniveau. Begleiterscheinung der militarisierten Drogenbekämpfung waren ausufernde Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Doch heute steht nicht mehr das pflanzenbasierte Kokain im Vordergrund, sondern das synthetisch hergestellte Fentanyl, das aus Mexiko kommt. Seit 2008 sind mehr als eine Million Menschen in den USA an Überdosen des starken Opioids Fentanyl gestorben. Nach Jahren stetigen Anstiegs geht ihre Zahl aktuell zurück. Während Trumps erster Amtszeit hatte sie sich vervierfacht. Die Biden-Administration hatte darauf mit einem Bündel von Maßnahmen der harm reduction (Schadensminderung) reagiert, während die Republikaner traditionell eher auf das Strafgesetzbuch setzen. Trump hat angekündigt, mexikanische Drogenorganisationen als Terrorgruppen einzustufen und bedroht die mexikanische Regierung mit Strafzöllen, um sie „zum Handeln zu zwingen“. In republikanischen Kreisen wurden darüber hinaus Militäreinsätze in Mexiko, einschließlich der US Special Forces angedacht. Die mexikanische Regierung dürfte über diesen Unilateralismus alles andere als begeistert sein, selbst wenn es im Endeffekt nicht so weit kommen sollte. Es drohen Gegenzölle und ein Handelskrieg zu beiderseitigem Nachteil. Gefragt wäre vielmehr Kooperation bei der Stärkung des Justizsystems und bei der Korruptionsbekämpfung. Der Fall Venezuela Hier darf man eine Rückkehr zur Politik der ersten Amtsperiode Trumps erwarten. Am Tag vor der Amtseinführung des selbsterklärten Wahlsiegers Nicolás Maduro benannte Donald Trump in einem Post dessen Gegenspieler Edmundo Gonzáles Urrutia als Präsident und lobte die Unterstützung für ihn durch die venezolanische Community in den USA. Marco Rubio sagte in seiner Anhörung als designierter Außenminister vor dem Kongress, das Land sei von kriminellen Organisationen und Drogenhändlern kontrolliert und kritisierte die Biden-Regierung für die Lockerung von Sanktionen. Trumps designierter Sicherheitsberater Michael Waltz traf Gonzáles Urrutia (noch in seiner Eigenschaft als Kongressabgeordneter für Florida) bei dessen Besuch in Washington. Dieser wirbt mit dem Argument, dass nach einem Systemwechsel Millionen Flüchtlinge freiwillig nach Venezuela zurückkehren würden. Maduro wiederum dürfte an einer Verlängerung der Öl-Lizenzen interessiert sein und könnte im Gegenzug bei publikumswirksamen Abschiebeflügen kooperieren. Venezuela ist der drittgrößte Öllieferant für die USA (2024) und Trump braucht Öl zur Reduzierung der Energiekosten („ drill baby drill“ ). Hier kommt der „Freihändler“ Richard Grenell ins Spiel, der bereits in der Vergangenheit mit Maduro verhandelt hat. Der Fall Kolumbien Kolumbien ist traditionell der wichtigste Verbündete der USA in der Region, die wichtigste Auffang- und Durchgangsstation für Migranten aus Venezuela und priorisiert den Handel mit den USA vor dem mit China – auch unter der Linksregierung von Präsident Gustavo Petro. Die USA haben dort im Rahmen des Drogenkriegs sieben Militärbasen. Zwar ist seit dem Friedensabkommen mit den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC) von 2016 die Gewalt im Land deutlich reduziert. Wichtig wäre heute Unterstützung beim Ausbau rechtsstaatlicher Präsenz in den von den FARC verlassenen Gebieten und die Bekämpfung der Konfliktursachen. Doch weiterhin bekämpfen sich die noch aktive Guerilla ELN ( Ejército de la Liberación Nacional ), FARC-Dissidenten (zuletzt in der Region Catatumbo, wo es um Transitrouten für Kokain geht), rechtsextreme Paramilitärs untereinander – und mit dem Militär. Alle zusammen werden sie GAI ( Grupos Armados Ilegales ) genannt und diese Gruppen kontrollieren einen Großteil der Kokainproduktion, die in Hochproduktivitätszonen vor allem im Süden Kolumbiens konzentriert ist und auf historischem Rekordniveau liegt. Hier bieten sich Kooperationsmöglichkeiten. Größer scheint jedoch die Gefahr, dass die Trump-Regierung auf die alten martialischen Strategien setzt und es darüber zu Auffassungsunterschieden mit der Regierung von Gustavo Petro kommt, die man bereits mit der Erpressung von Zwangsabschiebungen brüskiert hat. Schließlich hatte man bis vor zehn Jahren unter US-Regie in großem Stil Kokafelder mit Pflanzengift aus der Luft besprüht. Der Fall Zentralamerika Zentralamerika ist neben Mexiko die wichtigste Heimat von Migranten, die in die USA kommen. Die betroffenen Länder dürften mit der angedrohten Abschiebungspraxis unter erheblichen Druck geraten. Hierzu hat man in Washington noch keinerlei spezifische Maßnahmen definiert, doch dürfte eine Abkehr von der langfristig angelegten, proaktiven Politik der Ursachenbekämpfung erfolgen, für die Vizepräsidentin Kamala Harris zuständig war. Gewalt ist die wichtigste Fluchtursache dort. Durch Massenabschiebungen dürften Gewalt und Chaos zunehmen. So werden keine Probleme gelöst, sondern neue geschaffen. Politisch könnte Präsidentin Xiomara Castro in Honduras wegen ihrer Beziehungen zu Venezuela, Kuba, Nicaragua und China unter Druck geraten. Das Trump-Lager hatte ferner enge Beziehungen zu Leuten unterhalten, die in Guatemala wegen Korruption sanktioniert wurden. Sie könnten Frühlingsluft wittern. Der Fall Kuba Unter dem Druck des nunmehrigen Außenministers Marco Rubio hatte Trump in seiner ersten Amtszeit die Tauwetter-Politik unter Präsident Obama aufgehoben, neue Sanktionen verhängt, gemeinsame Arbeitsgruppen – etwa zu Migration, Menschenrechten und Umwelt – aufgelöst und Kuba wieder auf die Liste der Staaten gesetzt, die Terror unterstützen. Einige dieser Maßnahmen wurden von der Biden-Regierung aufgehoben. Die Streichung Kubas von der „Terrorliste“ erfolgte erst nach der Freilassung von 553 Inhaftierten kurz vor Ende seiner Amtszeit und wurde nun von Trump umgehend wieder rückgängig gemacht. Mit dem Exilkubaner Marco Rubio und anderen Hardlinern in Schlüsselpositionen dürfte sich die sowieso schon sehr begrenzte Entspannung der Beziehungen erledigen. Möglicherweise liegt in der Migration ein Anknüpfungspunkt für politischen Pragmatismus, die mit der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf der Insel seit 2022 auf Rekordhöhe liegt. Thema WHO Die Weltgesundheitsorganisation WHO mit Sitz in Genf bedauert in einem Statement den Austritt der USA. Mit 8.000 Beschäftigten ist sie die größte UNO-Unterorganisation. Sie wurde am 7. April 1948 zu dem Zweck gegründet, sich für „bestmögliche Gesundheit für alle“ einzusetzen. Zu ihren Erfolgen gehört der Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Polio und Pocken. Für viele Länder, gerade im globalen Süden, sind ihre Frühwarnungen, Koordination und Notfallfonds im Ernstfall lebenswichtig. Mit 18 Prozent sind die USA der größte Beitragszahler zum WHO-Budget. Der Austritt muss gegenüber dem UNO-Generalsekretär Guterres noch schriftlich erklärt werden, dann dauert es ein Jahr bis er wirksam wird. Thema Klima Die Klimakrise führt immer schneller zu immer mehr Katastrophen. Das zeigen zuletzt auch die verheerenden Brände in Kalifornien, für die Trump nur mangelhaften Katastrophenschutz verantwortlich macht. Allein im bolivianischen Amazonien sind im letzten Jahr 10 Millionen Hektar – eine Fläche größer als Österreich – abgebrannt (2023 waren es „nur“ 6,3 Millionen Hektar), während das Land nun, zur Regenzeit, unter Überschwemmungen leidet. Für Donald Trump ist die Klimakrise aber eine „Erfindung“ und er hat folgerichtig den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt, das mit seinem ohnehin inzwischen außer Reichweite geratendem 1,5 Prozent-Ziel am 12. Dezember 2015 beschlossen wurde. Ganz im Sinne der kurz vorher beschlossenen Agenda 2030, den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Eine weitere Abkehr vom Multilateralismus. Was sonst? Außenminister Marco Rubio hat alle Hilfsprogramme eingefroren. Es wird geprüft, ob sie in Trumps Konzept passen. Einschlägige Kooperationsprogramme zum Minderheitenschutz, Gender, Anti-Rassismus stehen ebenso zur Disposition wie die Unterstützung der in dieser Richtung aktiven NGOs. So erwartet etwa das WOLA die Rückkehr zur sogenannten Mexiko-City-Politik, die US-Hilfen an Organisationen untersagt, die Abtreibung befürworten, um nur ein Beispiel zu nennen. Der US-kolumbianische Anti-Rassismus-Aktionsplan könnten dem zum Opfer fallen. Für die nächsten zwei Jahre wird Trump eine republikanische Kongressmehrheit zur Durchsetzung seiner Politik hinter sich haben. Lateinamerika muss steifen Nordwind im Sinne der Unterstützung autoritärer Strömungen, Menschenrechtsprobleme sowie wirtschaftliche und geostrategische Herausforderungen befürchten. Geopolitik des Zugangs Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine ist die Geopolitik zurück auf der Agenda. Dabei hat Trump – neben den Drohungen an China – zuletzt Kopfschütteln ausgelöst, indem er ankündigte, Kanada als 51. Bundesstaat integrieren und Grönland kaufen sowie den Panama-Kanal notfalls militärisch besetzen zu wollen: „Make America Great Again“. Der in den USA geborene und emeritierte Politologe der Uni Wien, Mitchell Ash, unterscheidet im Trump-Team Erzkonservative, Milliardäre und Verrückte – und vielfach wurden die geopolitischen Begehrlichkeiten als verrückt abgetan. Ganz so einfach ist es nicht. Trump liebt es Drohkulissen und Druck aufzubauen. Ein weiteres Abschmelzen der Arktis würde neue Routen für die Schifffahrt eröffnen und den Seeweg von Westeuropa nach Asien um zwei Wochen verkürzen. Kontrollieren lassen sie sich von Grönland aus, das zum EU-Mitglied und NATO-Partner Dänemark gehört. Das Trump’sche Getöse mag in einem ersten Schritt Abspaltungstendenzen beflügeln. Über den Panama-Kanal laufen 5 Prozent des Welthandels. Besonders wichtig ist er für die Verbindung der US-Westküste nach Asien. Die USA sind auch stärkster Nutzer mit 40 Prozent der transportierten Container, vor China (21) und Japan mit 14 Prozent. Überhaupt ist der Kanal als solcher ein Produkt des US-Imperialismus. Nach einer militärischen Intervention wurde Panama im Jahr 1903 von Kolumbien abgespalten und noch im gleichen Jahr wurde der Vertrag zum Bau des Kanals unterzeichnet, der dann 1914 fertig gestellt wurde. Panama war mit der Howards Air Force Base bis 1999 das Hauptquartier des für Südamerika zuständigen Southern Command der US-Streitkräfte. Im gleichen Jahr wurde der Kanal aufgrund der Carter-Torrijos-Verträge von 1977 an Panama übergeben. Heute werden an beiden Enden des Kanals die Häfen von einer Tochter der CK Hutchinson Holding mit Sitz in Hong Kong bewirtschaftet, was nicht nur Trump beunruhigen dürfte, zumal es im vergangenen Jahr 2024 wegen Wassermangel zu ernsten Behinderungen und Gerangel um die Passagen kam. Gleichzeitig wurde durch den Beschuss der Huthi-Rebellen auch der Verkehr durch den Suez Kanal behindert. Damit nicht genug wurde im November 2024 durch die peruanische Präsidentin Dina Boluarte, deren linker Vorgänger im Dezember 2022 durch einen kalten Putsch ins Gefängnis befördert worden war, der Hafen Chancay bei Lima eröffnet. Die Eröffnung erfolgte im Beisein des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die staatliche chinesische Schifffahrtsgesellschaft COSCO hatte 3,4 Milliarden USD investiert. Der Sonderbeauftragte Claver-Carone trat mit dem Vorschlag hervor, Waren, die den Hafen von Chancay durchlaufen, mit 60 Prozent Zoll zu belegen. Zusammen mit Argentinien bauen die USA ihrerseits in aller Stille an einer gemeinsamen Marinebasis in Ushuaia, dem Tor zur Antarktis, wie bei einem gemeinsamen Besuch der Southcom Chefin Generalin Laura Richardson, dem US Botschafter und Präsident Javier Milei im April 2024 deutlich wurde. Nach Verlegung des Southcom aus Panama war die Basis auf dem ecuadorianischen Flughafen Manta (1999-2009) das Zentrum der militärischen US-Aktivitäten in Südamerika. Die Verträge wurden jedoch vom damaligen Präsidenten Rafael Correa nicht verlängert. Der aktuelle ecuadorianische Präsident Daniel Noboa würde sie gerne erneuern, was inzwischen aber gegen die Verfassung verstieße. Ferner braucht er die Unterstützung Washingtons bei seiner Politik der harten Hand im Kampf gegen den Drogenhandel, womit er im Weißen Haus offene Türen einrennen dürfte. Generalin Laura Richardson war es auch, die sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich um den Verlust der Kontrolle in Sachen Rohstoffe zu Gunsten Chinas sorgte. Hier geht es insbesondere um Kupfer und Lithium. Beides braucht man für Elektroautos und Tesla-Chef Musk dürfte ein massives Interesse am Lithium-Dreieck Argentinien, Bolivien, Chile haben. Chile ist vor Peru auch der weltgrößte Kupferproduzent. Die weltweit größten Lithium-Reserven liegen in Bolivien. Am 12. Dezember 2018 war in Berlin im Beisein des bolivianischen Außenministers und des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier ein Joint Venture zur Lithiumgewinnung gegründet worden. Bis zum November 2019 saß der beteiligte baden-württembergische Mittelständler auf unterschriftsreifen Verträgen, die dann auf Eis gelegt wurden, was zu Spekulationen über eine Beteiligung von Mitkonkurrenten am seinerzeitigen Sturz der Regierung Morales Anlass gab, zumal Elon Musk, darauf angesprochen, in seiner bekannt flapsigen Art später sagte: „Wir stürzen wen wir wollen.“ Zweifellos hätte er die finanziellen Mittel dazu. Sicher ist, dass es auch innerhalb Boliviens Widerstände gegen die Verträge gab. Nachdem eine demokratisch gewählte Regierung Ende 2020 die Regierungsgeschäfte in La Paz übernahm wurden auch Verhandlungen wiederaufgenommen, an denen aber kein europäisches Land mehr beteiligt war, was möglicherweise der zweifelhaften Rolle des damaligen EU-Botschafters León de la Torre bei der Machtergreifung der politischen Rechten geschuldet ist. Investiert haben inzwischen chinesische und ein russisches Unternehmen im bolivianischen Salar de Uyuni. Nicht nur im Lithium-Dreieck hat China die USA überholt. Chinas Handelsvolumen mit Lateinamerika ist zwischen 2000 und 2022 von 12 auf 485 Milliarden USD gestiegen. Stark gewachsen ist auch die Bedeutung chinesischer Kredite. Für Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ist China der wichtigste Handelspartner. Drängen die USA unter Trump nun in ihren alten Hinterhof – gemäß der Monroe-Doktrin von 1823 – zurück? Diese war mit ihrem „hands off Latin America“ gegen den europäischen Imperialismus gerichtet. Heute könnte es darum gehen, Terrain zurück zu gewinnen. Allzu großes Gepolter dürfte dabei nicht hilfreich sein, zumal die progressiven Länder heute besser untereinander vernetzt sind und mit China eine mächtige Alternative haben. So erfolgten beispielsweise auf die aktuellen Drohungen gegen Mexiko und Panama umgehend Solidaritätsbekundungen aus dem Süden. Während die Lateinamerikaner auf Diversifizierung ihrer Beziehungen setzen, hat Europa ihre Avancen stets eher verpuffen lassen und ist im außenpolitischen „Beiwagerl“ Washingtons sitzen geblieben, wo Präsident Trump nun wieder mit der Abkoppelung droht. Wie auch immer: Vieles von dem, was Trump mit Pauken und Trompeten ankündigt, wird sich so gar nicht umsetzen lassen und könnte letztlich auch für die Vereinigten Staaten und seine Oligarchen selbst kontraproduktiv sein. Ungeachtet dessen dürften damit große Probleme für Lateinamerika verbunden sein. Wie ein Blick auf Lateinamerika zeigt: Das Liebäugeln mit dessen Politikstil sowie unilaterale und autoritäre Ansätze führen in die Sackgasse und schaffen mehr Probleme als sie lösen. In einer Zeit multipler und sich verschärfender Krisen ist damit zusätzlich die Gefahr zunehmender Konflikte und eines Abgleitens in den Faschismus verbunden. * Näheres siehe Lessmann, Der Drogenkrieg in den Anden, Wiesbaden, 2016; Bureau for International Narcotics Matters and Law Enforcement Affairs ; UNODC United Nations Office on Drugs and Crime.

Es scheint, als ob die Regierung von Nicolás Maduro trotz offensichtlicher Wahlfälschungen, breiter Proteste und internationaler Kritik, z um B eispiel von den Regierungen Kolumbiens, Chiles und Brasiliens, an der Macht bleiben kann. Wie siehst Du die Situation heute in Venezuela? Die aktuelle Situation in Venezuela ist durch das Zusammenwirken verschiedener Ereignisse gekennzeichnet. Erstens haben der Wahlbetrug vom 28. Juli und die Geschehnisse rund um die Wahl die venezolanische Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Die Wahlbeteiligung war mit 73 Prozent sehr hoch. Unabhängige Wahlbeobachter:innen achteten darauf, dass es keine Unregelmäßigkeiten gab. Am Ende des Wahltages gab es nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Regierung die Wahl verloren hatte, und zwar eindeutig. Der Mythos, die venezolanische Gesellschaft würde mehrheitlich hinter dem Chavismus stehen, wurde an diesem Tag ein für alle Mal zerstört. Die Regierung hat nicht die geringste Chance, wieder Vertrauen von der Bevölkerung zu erhalten. Maduro hat sich mit der Behauptung, er habe die Wahlen gewonnen, gegen die Bevölkerung gestellt und für den Weg der Repression entschieden. In den Tagen nach der Wahl wurden mehr als 2000 Personen inhaftiert, etwa 100 Jugendliche wurden mit Vorwurf des Terrorismus inhaftiert. Dieses brutale Vorgehen hat Angst, Unsicherheit und Verwirrung in der Bevölkerung ausgelöst. Es ist immer noch unklar, wie der repressiven und autoritären Haltung der Regierung begegnet werden soll. Ein Aufstand der Bevölkerung, der die Regierung bedrohen könnte, ist keine Option. Die venezolanische Gesellschaft verfügt schlichtweg über keinen Organisationsgrad, mit dem er gelingen könnte. Zudem haben die Leute Angst. Zweitens ist das, was die Regierung gerade inszeniert, nicht einfach nur die Nichtanerkennung einer Wahlniederlage unter Beibehaltung der bestehenden institutionellen Ordnung. Was in Venezuela gerade passiert, ist die schrittweise Etablierung einer zunehmend autoritären Rechtsordnung. Die Negation der Wahlniederlage ist ein weiterer Schritt in einem Prozess, der sich bereits länger angekündigt hat. In den letzten Jahren hat die Regierung eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, etwa das Gesetz gegen Hass, das Gesetz gegen Terrorismus oder das Gesetz gegen Faschismus. Mit diesen Gesetzen wurden die demokratischen Grundrechte immer mehr eingeschränkt und die Befugnisse der Regierung und des Präsidenten mehr und mehr ausgeweitet. Mit diesen neuen Gesetzen hat die Regierung die politische Debatte im Land verändert, der Ton ist zunehmend autoritär. Konzepte wie Hass oder Terrorismus werden wahllos eingesetzt, um politische Gegner:innen auszuschalten. Der Vorwurf des Terrorismus kann Haftstrafen von 20-30 Jahren zur Folge haben. Was wir gerade beobachten, ist keine improvisierte Reaktion auf eine Wahlniederlage, sondern die schrittweise Durchsetzung eines autoritären Projektes. Allerdings markiert der 28. Juli 2024 einen profunden Wendepunkt in diesem Prozess: Wenn die Souveränität der Bevölkerung und die Verfassung missachtet werden, dann hört die Demokratie auf zu existieren. Hast Du die Reaktion der Regierung so erwartet oder bist Du davon ausgegangen, dass Maduro einen Sieg der Opposition akzeptieren würde? Die Erfahrungen von Übergängen vom Autoritarismus zur Demokratie in den verschiedenen Teilen der Welt haben gezeigt, dass Übergänge meistens ausgehandelt werden, vor allem dann, wenn es keine Kraft gibt, die in der Lage ist, eine Regierung zu besiegen. Es kommt zu einem paktierten Übergang, einem Pakt zwischen alten und neuen politischen Eliten. Das war in Chile zum Ende der Pinochet-Diktatur so, in Spanien, in Griechenland. In Venezuela gab es im Vorfeld zurückliegender Wahlen Diskussionen hierzu. Diesmal war es anders. Anders als sonst, entschied sich die Opposition für die Teilnahme an den Wahlen. In den Jahren zuvor hatte sie zur Wahlenthaltung aufgerufen mit dem Ziel, die Regierung zu delegitimieren, nach dem Motto, „die Regierung betrügt eh, eine Wahlbeteiligung lohnt sich nicht“. Einige Oppositionelle forderten sogar die USA auf, in Venezuela zu intervenieren. Das war diesmal anders. Die Opposition begann sich zu organisieren und für die Wahl zu mobilisieren. Nachdem den meisten der möglichen Oppositionskandidat:innen die Einschreibung zur Wahl verweigert wurde, blieb am Ende fast zufällig Edmundo González als Präsidentschaftskandidat der Opposition übrig. Zu diesem Zeitpunkt ging es für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr darum, wer der Kandidat der Opposition war, sondern darum, Maduro zu besiegen. Das politische Programm war vollkommen egal. Und zwar so sehr, dass innerhalb von zwei Wochen eine Person, die der großen Mehrheit der Bevölkerung völlig unbekannt war, viel mehr Unterstützung in der Bevölkerung erhielt als Maduro. González wurde zu dem Kandidat, der Maduro besiegen konnte. Um auf das Thema der ausgehandelten Übergänge zurückzukommen: In den vergangenen Jahren und besonders in den Monaten vor Wahlen, wurde in Venezuela immer viel über die Möglichkeit von Verhandlungen diskutiert. Gefragt wurde, wie sich die Kosten des Verbleibs für die Regierung erhöhen oder die Kosten des Ausstiegs senken ließen. Das gab es diesmal nicht. María Corina Machado [Anführerin der rechten Opposition, der 2023 die Ausübung politischer Ämter für 15 Jahre seitens der Maduro-Regierung untersagt wurde] sprach stattdessen davon, Maduro inhaftiert sehen zu wollen. Die US-Regierung lobte eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Informationen aus, die es erlauben würden, diesen „Kriminellen“ [Maduro] zu fassen. All das machte jeden Raum für Verhandlungen zu. Der Diskurs der Opposition und die US-Politik haben in gewisser Weise dazu beigetragen, dass Maduro sich radikalisierte. Nach dem Motto: „Wenn die Aufgabe der Präsidentschaft bedeutet, dass sie mich inhaftieren, meine Ersparnisse konfiszieren und der Chavismus als Bewegung zerstört wird, dann bleibt nur eins: Bis zum Ende an der Macht festhalten“. Weder in den Positionen der rechtsgerichteten nationalen Kräfte, noch in jenen der US-Regierung eröffneten sich Chancen für einen Verhandlungsübergang. Du sprichst von der Regierung Maduro als von einem „zivil-militärisch-polizeilichen Regime“. Was meinst Du damit? Die Allianz zwischen Regierung, Militär und Polizei wird zunehmend deutlich. Das war vor den Wahlen bereits so, aber eher diskret, nun wird es immer klarer und öffentlich sichtbar. Nach den Wahlen gab es eine gemeinsame Pressekonferenz des Oberkommandos des Militärs und des Oberkommandos der Polizei, die Maduro absolute Rückendeckung gaben und den Wahlsieg Maduros anerkannten. Das bedeutete einen Bruch. Dass die Militärs autoritäre Regierungen vorbehaltlos unterstützen, ist ein trauriger Teil der Geschichte Lateinamerikas. Aber dass die Polizei sich dem öffentlich anschließt ist ein Novum und weist eindeutig in Richtung Autoritarismus. Als Chávez zum ersten Mal für die Präsidentschaft kandidierte, appellierte er an die zivil-militärische Union, denn er war ein Vertreter des Militärs. Er appellierte an die Idee, dass das Militär zusammen mit zivilen Kräften die Gesellschaft verändern könnte. Das Thema der zivil-militärischen Union gab es also schon vor der ersten Wahl von Chávez zum Präsidenten. Aber wenn zu dieser Union jetzt noch die Polizei hinzugefügt wird, ist das so, wie einen Polizeistaat auszurufen. Das ist sehr ernst. Wie ist die wirtschaftliche Situation im Land? Welche wirtschaftlichen Interessen stehen hinter diesem Bündnis? Die allgemeine Situation des Landes ist katastrophal. Es gibt einen bekannten venezolanischen Wirtschaftswissenschaftler, der vor Kurzem zynisch bemerkte, dass die Situation der venezolanischen Wirtschaft sehr stabil sei. Stabil im Graben, sie bewege sich nicht. Das Inlandsprodukt beträgt etwa 20 Prozent dessen, was es vor 10 Jahren war – ein Einbruch von 80 Prozent der Wertschöpfung in zehn Jahren. So etwas kommt nicht mal in Kriegszeiten vor. Und das bedeutet, dass die Beschäftigungslage katastrophal ist. Der Mindestlohn liegt bei drei Dollar im Monat, das Bildungs- und das Gesundheitssystem brechen zusammen. In den Grundschulen kommen die Lehrer:innen manchmal zwei Tage in der Woche zum Unterrichten. An den anderen Tagen versuchen sie, andere Einkommensquellen zu erschließen, um zu überleben. Die Krankenhäuser erfüllen nicht die Anforderungen des öffentlichen Gesundheitswesens, die Zahl der Krankenschwestern, die das Land verlassen haben, ist extrem hoch. Die Löhne reichen nicht zum Überleben. Insgesamt haben 25-30 Prozent der Bevölkerung das Land verlassen. Die jungen Leute haben das Gefühl, dass sie ihrer Zukunft beraubt wurden, dass wir uns in einem Land befinden, in dem es keine Zukunft gibt. Das Land zu verlassen stellt für viele die einzige reale Alternative dar. Aber wenn die Alternative für die Jüngeren nicht der politische Aktivismus, der soziale Kampf und die Konfrontation mit der Regierung ist, sondern das Verlassen des Landes, weil sie die Hoffnung verloren haben, dann ist das dramatisch. Wie viele Menschen haben ungefähr das Land verlassen? Die Schätzungen variieren, sie liegen zwischen sieben und acht Millionen Menschen in einem Land mit vormals 30 Millionen Einwohner:innen. Die Emigration begann langsam vor etwa zehn Jahren und hat in den letzten sechs Jahren stark zugenommen. Die zweitgrößte Stadt Maracaibo ist wahrscheinlich die Stadt mit der höchsten Abwanderungsrate. Manche schätzen, dass bereits 40 Prozent der ehemaligen Bewohner:innen die Stadt verlassen haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die soziale und materielle Infrastruktur, die Gebäude, den sozialen Zusammenhalt. Alles bricht zusammen. Inwieweit zieht der politisch-militärisch-polizeiliche Block auch wirtschaftliche Vorteile aus der aktuellen Situation? Wie gesagt, die Regierung Chávez war eine zivil-militärische Regierung. Das Militär hatte viel Macht und hatte wichtige Positionen inne, was schon damals zu viel Korruption führte. Eine entscheidende Institution in diesem Zusammenhang war in den Jahren der Chávez-Regierung die Stelle, die für den Kauf von Devisen zuständig war. Der Unterschied zwischen dem offiziellen Dollar, der dort ausgegeben wurde, und dem Marktdollar betrug in einigen Fällen 10 zu 1. Wer also an die Devisen des offiziellen Dollars kam, konnte sich bereichern. Mit einem Wechsel im Direktorium der venezolanischen Zentralbank flog das alles auf. Die neue Direktorin begann die Konten zu überprüfen und stellte fest, dass in jenem Jahr die Ausgaben von 20 Milliarden Dollar nicht belegt waren. Es handelte sich angeblich um Importe des Staates, aber es gab keine Belege dafür, dass sie tatsächlich getätigt worden waren. Allein in einem Jahr. Und sie wurde bald entlassen. Natürlich. Mit Maduro hat sich diese Korruption deutlich verschlimmert. Chávez kam aus dem Militär, er hatte von dort politisch-ideologische Unterstützung und seine Führung war anerkannt. Nicht so bei Maduro, der Zivilist aus einer linken Partei war, der Sozialistischen Einheitspartei Venezuelas. Er musste seine eigene Unterstützung durch das Militär aufbauen, und das tat er im Wesentlichen, indem er die Macht mit dem Militär teilte und viele öffentliche Führungspositionen an das Militär gab. Schon unter Chávez und unter dem Einfluss Kubas wurden viele Unternehmen verstaatlicht, was zur wirtschaftlichen Krise beitrug, denn es fehlte oft ein angemessenes Management, das Interesse an einer Entwicklung der Produktion hatte. Sie wurden staatlich subventioniert. Der Hintergrund der fehlenden Produktivität ist dramatisch: Die Regierung hat in den letzten 25 Jahren nie ein eigenständiges wirtschaftliches Projekt entwickelt. Im Zentrum stand immer die Verteilung des Ölüberschusses. Als diese Überschüsse und die Subventionen nachließen, fehlten die Möglichkeiten eigenständig zu investieren, sich technologisch zu erneuern, Betriebsmittel zu kaufen. Dazu kommen Wirtschaftssanktionen der USA. Beides zusammen hat die Wirtschaft des Landes zerstört. Eine Wirtschaft, die 100 Jahre lang auf der Grundlage von Öl funktioniert hat. Der Staat war der große Verteiler der Öleinnahmen, was die gesamte Wirtschaftstätigkeit aufrechterhielt. Vor ein paar Jahren gab es ein Projekt der Regierung, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch mit der Erschließung des sogenannten Orinoco-Bergbaubogens ( Arco Minero del Orinoco ) entgegenzuwirken. Zusätzlich zum Öl sollten mit Bergbau Devisen ins Land kommen. Wie hat sich dieses super-extraktivistische Projekt entwickelt? Erstens wurde erkannt, dass die Ölförderung als Grundlage der Volkswirtschaft erschöpft ist. Die Fördermöglichkeiten nahmen ab, die starken Preisschwankungen auf dem Weltmarkt führten immer wieder zu Einbrüchen bei den Devisen- und Staatseinnahmen. Gleichzeitig gab es seitens der Bevölkerung die Erwartung, dass die Wirtschaft weiter wachsen würde, der Staat genug Mittel hätte und sich die Lebensbedingungen verbessern würden. Doch es wurde, wie gesagt, kein alternatives Projekt zur Schaffung von Wohlstand entwickelt. So etwas benötigt ja auch Zeit. Stattdessen verkündete die Regierung im Februar 2016, den Bergbau massiv zu fördern. Gerechtfertigt wurde das damit, dass der illegale Kleinbergbau verschwinden müsse, Ordnung zu schaffen sei und große Unternehmen, vor allem Goldfirmen aus Kanada, investieren sollten. Das Gold sollte das Öl ersetzen. Aber das ist nie passiert, unter anderem weil den internationalen Unternehmen die Rechtssicherheit fehlte. Die großen Investoren blieben also aus. Stattdessen entwickelte sich ein informeller Goldbergbau im Orinoco-Gebiet, an dem sich Teile des Militär, die kolumbianische Guerilla ELN, kolumbianische Paramilitärs und verschiedene venezolanische nichtstaatliche Akteure bereichern. Unter diesen Akteuren bildeten sich so genannte Syndikate, also nicht staatliche Gewaltakteure heraus, die die Herrschaft in der Orinoco-Region übernahmen. Sie kontrollieren weite Teile der Region, schlichten lokale Streitigkeiten, kontrollieren den Goldbergbau, bestimmen den Preis, zu dem Gold verkauft werden kann. Kommen denn überhaupt internationale Investitionen nach Venezuela? Welche Rolle spielt dabei die US-Regierung? Aktuell kommen nur sehr wenige ausländische Investitionen ins Land. Anfang Oktober war in der Presse zu lesen, dass die Regierung Biden die Genehmigung für Chevron, in Venezuela Öl zu fördern und in die USA zu exportieren, bis April nächsten Jahres verlängert. Die Venezuela-Politik der US-Regierung ist durch kurzfristige und langfristige Interessen gekennzeichnet, die nicht unbedingt übereinstimmen. Zum einen verfolgt die US-Regierung die Strategie der kurzfristigen Stabilisierung der venezolanischen Situation, das heißt größtmögliche Stabilität im Inneren Venezuelas, um die politischen Kosten einer steigenden venezolanischen Migration im US-Wahlkampf gering zu halten. Nur so ist zu erklären, dass die US-Regierung auf den Wahlbetrug nicht mit mehr Sanktionen reagiert hat. Sie weiß, dass weitere Sanktionen zu verstärkter Migration, weiterer Verschlechterung und größerer Instabilität führen würden. Nach den Wahlen könnte sich dies also ändern. Zum anderen bestimmt der langfristige geopolitische Wettbewerb mit China und der Krieg in der Ukraine die US-Außenpolitik in Bezug auf Venezuela. Die Vereinigten Staaten sind daran interessiert, mehr Öl auf den Markt zu bringen, zur Not eben aus Venezuela, damit die europäischen Staaten nicht in die Versuchung geraten, fossile Energien wieder aus Russland zu kaufen. Gleichzeitig haben die Chinesen die Geduld mit Venezuela verloren. Venezuela schuldet China etwa 60 Milliarden Dollar an Krediten, die es seit einiger Zeit nicht bezahlt hat, die es vermutlich auch nicht bezahlen wird. Eine ökonomische Unterstützung aus China gibt es praktisch nicht mehr. Zwar arbeiten auch weiterhin chinesische Unternehmen in Venezuela, etwa im Bereich Infrastruktur oder Ölförderung. Die unterscheiden sich in Bezug auf Ausbeutung aber nicht von anderen transnationalen Unternehmen. Welche Rolle spielen die Rücküberweisungen der Migrant:innen für die Stabilität der Wirtschaft? Ich kenne keine verlässlichen Schätzungen. Ein beträchtlicher Teil der Menschen, die das Land verlassen haben, stammen aus sozialen Schichten mit niedrigen Einkommen. Ihre Einkommensmöglichkeiten in den Ankunftsländern sind begrenzt. Entsprechend gering sind die Überweisungen nach Venezuela. Dennoch ist natürlich der Unterschied für Familien, die zwischen einem Mindestlohn von 3 Dollar pro Monat in Venezuela und einer Überweisung von 50 Dollar liegen, sehr groß. Das Thema Migration hat in Venezuela eine tiefe gesellschaftliche Wunde erzeugt. Alle sind betroffen; da ist etwa das Drama der Großmütter, die davon überzeugt sind, dass sie ihre Enkel:innen nie wieder sehen werden. Eines der Dinge, die die Kandidatin der Opposition, María Corina Machado, in ihrer Wahlkampagne vorgeschlagen hat, ist, dass die Kinder zurückkehren können sollten, damit die Mütter ihre Kinder sehen können. Das ist etwas, was die Gefühle der Menschen direkt anspricht. Die Migration ist eine Realität, die das soziale Gefüge der venezolanischen Gesellschaft und der Familien zerreißt. Wie fühlt sich die enorme Auswanderung im Alltag an? Was bedeutet das für das soziale Gefüge? Für die verschiedenen sozialen Schichten bedeutet es natürlich Unterschiedliches. Die mittleren und oberen sozialen Schichten haben die Möglichkeit zu reisen und können ihre Verwandten besuchen. In den ärmeren Schichten wird es als eine Art Herzschmerz empfunden, dass etwa Enkelkinder geboren werden und die Großeltern sie nie kennen lernen werden. Da ist dieses Gefühl, dass es sich um einen unumkehrbaren Prozess handelt. Was macht aktuell die Opposition und was machen die sozialen Bewegungen? Bei der Opposition handelt es sich um ein heterogenes Spektrum verschiedener Sektoren. Was in Venezuela als Opposition bezeichnet wird ist ein Bündnis rechter Parteien, das Edmundo González Urrutia und María Corina Machado unterstützte. Offensichtlich dachte dieser Sektor, dass den Umfragen und den Mobilisierungen zufolge die Niederlage der Regierung so absolut vernichtend sein würde, dass die Regierung keine andere Wahl hätte, als die Macht abzugeben. Doch, wie bereits weiter oben erwähnt, war das nicht möglich. Sie hatten viele Beobachter:innen bei den Wahlen, Zeugen bei der Abstimmung, Kopien der Protokolle, die sie veröffentlichten, um die Niederlage zu belegen. Aber anscheinend gab es keinen Plan, wie man den Kampf fortsetzen könnte, falls die Regierung so reagieren würde, wie sie reagiert. Also sind sie gelähmt. María Machado traut sich nicht, die Leute zum Straßenprotest zu mobilisieren, weil es zu viele Repressionen gibt. Sie ist quasi untergetaucht, man hat sie schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Sie ist zwar ständig auf Pressekonferenzen, aber die sind alle virtuell. Es ist schwer zu sagen, wie lange es dauert, bis ihr Aufenthaltsort bekannt wird. Edmundo González hat das Land verlassen und ist mittlerweile in Spanien. Jenseits der rechten Opposition gibt es Sektoren und Gruppen, die die Notwendigkeit der Bildung eines breiten Bündnisses gegen die Regierung erkennen. Die emanzipatorische Linke alleine wird den Widerstand nicht leisten können. Es bedarf einer Art breiten Front zur Verteidigung der Demokratie und der Verfassung. Es gibt einige Schritte in diese Richtung, aber das wird nicht von heute auf morgen geschehen. So hat zum Beispiel einer der Präsidentschaftskandidaten einer Partei, die sich für soziale Fragen einsetzt aber nur sehr wenig Stimmen erhalten hat, eine sehr aktive öffentliche Rolle in den letzten Wochen eingenommen und alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumente genutzt, um den Wahlbetrug anzuprangern. Ende September hat er bei der höchsten Berufungsinstanz Venezuelas, der Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs, einen Antrag auf Aufhebung der Entscheidung der Wahlkammer gestellt, die den Betrug besiegelte. Dafür hat er ein 80-seitiges Papier vorgelegt, in dem er sehr präzise und minutiös alle Artikel der Verfassung, von Wahlgesetzen und gesetzlich geregelter Verfahrensabläufe auflistet, die während der Wahlen verletzt wurden. Eine kleine, mehr oder weniger repräsentative Gruppe der Zivilgesellschaft hat das Dokument unterschrieben, unter anderem wir als Bürger:innen-Plattform zur Verteidigung der Verfassung in Venezuela. Das hat viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erzeugt, was sehr gut war. Die Idee im Moment ist, viele kleinere Aktionen zu unternehmen, um die Kritik und den Druck aufrechtzuerhalten, auch wenn es keinen Masterplan zum Sturz einer Diktatur gibt. Es geht vielmehr darum Kanäle offen zu halten, über die die Menschen ihre Unzufriedenheit ausdrücken, ihren Protest formulieren und artikulieren können. Und es geht aktuell darum, überhaupt wieder Vertrauen herzustellen zum Beispiel mit den konservativen politischen Sektoren, zu denen es viel Misstrauen gibt. Es gibt viele Leute, die schnell von Ultrarechten oder Faschismus sprechen. Ich denke, wir müssen stärker differenzieren und sprachlich abrüsten, wenn wir irgendwie eine breite Allianz aufbauen wollen, bei allen politischen Differenzen, die es klarer Weise gibt. Was bedeutet das? Wie kann das gelingen? Aktuell müssen wir es schaffen vom Links-Rechts-Gegensatz zum Gegensatz zwischen Autoritarismus und Demokratie zu kommen. Wenn das erreicht ist, dann werden wir sehen, wie konkrete Alternativen weiter politisch diskutiert werden und welches Land wir wollen. Aber im Moment ist das einfach nicht möglich. Seit 1999 war Venezuela eine Referenz für die globale Linke. Chávez erklärte um 2007 herum das Ziel, den Sozialismus im 21. Jahrhundert zu verwirklichen. Was können wir als internationalistische globale Linke aus den letzten 25 Jahren in Venezuela lernen? Ich würde diese Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Die erste bezieht sich auf die Notwendigkeit der Selbstkritik hinsichtlich der Bewertung der venezolanischen Entwicklungen. Rückblickend zeigt sich eine große politische Blindheit gegenüber den Entwicklungen in Venezuela. Das hat viel mit einem dogmatischen Glauben an die Revolution zu tun. Es gab in der Tat schon früh Anzeichen autoritärer Tendenzen, etwa den Messianismus von Chávez, die massive Präsenz des Militärs, die Betonung des Extraktivismus, das Fehlen eines alternativen Produktionsmodells. Später, als Chávez in 2007 die Revolution als sozialistisch deklarierte, identifizierte man Sozialismus mit Etatismus, mit jenen Konsequenzen für die Wirtschaft, auf die ich oben hingewiesen habe. Und mit Folgen für die demokratische Basisorganisation. Die erfolgte in den ersten Jahren der Regierung Chávez oft spontan, von unten, mit oder ohne Unterstützung der Regierung, inklusiv und vielfältig und mit umfassenden sozialen Errungenschaften wie der Alphabetisierung, Zugang zu Wasser, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Spätestens die Entscheidung Chávez‘, eine sozialistische Einheitspartei zu gründen, der sich alle Koalitionspartner unterordnen sollten, stellte eine Zäsur dar. Das alles geschah mit einem völligen Mangel an historischem Problembewusstsein, nicht nur hinsichtlich des sowjetischen Sozialismus. In Venezuela gab es in den 1960er Jahren eine sehr ernsthafte Debatte über die Erfahrung des Sozialismus und der Einheitspartei, über Alternativen, über das Verhältnis von Partei und Bewegungen. Diese Diskussion verschwand aus dem politischen Bewusstsein der jüngeren Generationen. Als der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ausgerufen wurde, war es, als würde man von Null beginnen, ohne irgendeinen Blick zurück. Wie kann man nach den Erfahrungen des sowjetischen Sozialismus zur Bildung einer Einheitspartei aufrufen? Irgendetwas aus dieser Geschichte muss man doch lernen im Sinne von „wie können wir verhindern, dass dieselben autoritären Tendenzen entstehen“? Als sich die Revolution für sozialistisch erklärte, nahm der kubanische Einfluss in einem außerordentlich Maße zu. Man schickte viele junge Leute zur ideologischen Schulung nach Kuba. Das waren junge Leute, die absolut an den Sozialismus glaubten, daran, dass dies die Wahrheit war und das, was getan werden musste. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wie diese [etatistische] Vorstellung von sozialistisch und revolutionär die demokratischen Basisorganisationen beeinflusste. Nach und nach wurde ein umfassendes Institutionengefüge von oben aufgebaut, mit klaren Vorgaben, wie die Basisorganisationen, etwa die Gemeinderäte gebildet werden sollten. Es wurde ein ganzer Apparat geschaffen, der absolut vom Staat bestimmt und finanziert wurde. Ab wann nahmen diese starken Regulierungen und Vereinheitlichungen zu? Das war ab 2008 noch unter Chávez. Dann kam das Problem hinzu, dass es abgesehen vom Diskurs, kein alternatives Projekt zum Öl gab, das zur Schaffung von Wohlstand führte. Die angesprochenen lokalen Basisorganisationen wurden auch aus den Öleinnahmen finanziert. Und mit den finanziellen Ressourcen erfolgte die politische Loyalität. Die ehemals reiche Erfahrung der Vielfalt basisdemokratischer Organisation wurde schließlich Teil des Staates und der Partei. Ohne jegliche Autonomie. Was sind die Lehren hieraus? Ist ein anderer, demokratischer „Sozialismus im 21. Jahrhundert“ möglich? Ich bin überzeugt, dass wir die Verbindung zwischen links sein und dem Begriff des Sozialismus vollständig aufgeben müssen. Der Sozialismus als historische Erfahrung ist gescheitert – und zwar überall auf der Welt. In Afrika, in Asien, in Europa, in Osteuropa, in Lateinamerika. Und jede dieser Erfahrungen endete ausnahmslos in einem autoritären Regime. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir denken sollten, der Kapitalismus sei für ewig. Die antikapitalistischen Kämpfe und die Kämpfe dessen, was wir historisch als Linke definiert haben, sind viel breiter angelegt. Viele der theoretischen Interpretationen eines Teils des Marxismus, diese Vorstellungen von Stufen, von der Linearität des historischen Seins, des historischen Subjekts, sind gescheitert. Dennoch haben sie zusammen mit dem Lagerdenken und der Logik des Kalten Krieges in Teilen der Linken weiterhin ein großes Gewicht. So unterstützt das Forum von São Paulo, das wichtigste Bündnis linker Parteien und Bewegungen in Lateinamerika, auch weiterhin die Regierung von Daniel Ortega in Nicaragua und natürlich auch die von Maduro. Damit schaden sie der Linken zutiefst. Denn wenn wir eine Regierung „links“ nennen, die autoritär, repressiv, korrupt und extraktivistisch ist, dann stehen wir auf der Seite der Rechten. Ulrich Brand (Universität Wien) und Kristina Dietz (Universität Kassel) führten das Gespräch Anfang Oktober beim Treffen der vom Anden-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanzierten, seit 2011 bestehenden Permanenten Arbeitsgruppe „Alternativen zu Entwicklung“, deren Mitglied auch Lander ist, der darüber hinaus auch der erwähnten Plattform zur Verteidigung der Verfassung in Venezuela angehört. Foto Edgardo Lander © RLS

Cali, Baku, Rio. Es war ein Herbst der Gipfel. Der Gipfel ohne Höhepunkte, der Gipfel ohne Ankommen – im Sinne von angemessenen und glaubwürdigen Ergebnissen. Als ob die Welt Zeit hätte. Wirbelstürme in der Karibik und den USA, ja selbst in Südeuropa. Taifune in Taiwan und China. Unwetter kennen keine ideologischen - oder Landesgrenzen. Starkregen und Überflutungen in Nepal, Frankreich, in Spanien mit mehr als 200 Todesopfern, ja auch in Österreich. Brände in Griechenland und in Amazonien. In Indien fällt wegen Smog der Schulunterricht aus. Man soll im Haus bleiben. Die Besucher der COP 16 Artenschutz-Konferenz in Cali wurden dort von Ascheregen begrüßt, immer noch eine Begleiterscheinung der Zuckerrohrernte. Bolivien erlebte die schlimmste Naturkatastrophe seiner Geschichte und rief einen nationalen Notstand aus. Rund zehn Millionen Hektar – eine Fläche deutlich größer als Österreich – im amazonischen Umland sind abgebrannt. Im Vorjahr waren es „nur“ 6,3 Millionen Hektar. Es geht um’s Klima, es geht um die Welt. Und immer wieder geht es dabei um Amazonien, ihre „grüne Lunge“. Es geht darum, Kipppunkte zu vermeiden, points of no return , wo die Schäden irreversibel sind und selbst weitere Schäden hervorrufen. In dieser Lage lassen Berichte der Vereinten Nationen und von NGOs aufhorchen, die vor einer gefährlichen Verknüpfung von Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und dem Organisierten Verbrechen in Amazonien warnen, wodurch eine neue Dynamik entsteht. Es war bei einem Lokalaugenschein im TIPNIS, einem Natur- und Indígena-Schutzgebiet (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Securé; letzteres sind zwei Flüsse, die das Schutzgebiet eingrenzen) am Fuße der Andenkette, wo die Berge enden und Amazonien beginnt. Damals waren Proteste von Umweltschützern und indigenen Vertretern gegen ein Straßenbauprojekt durch das unzugängliche Regenwaldgebiet von der Größe Tirols die erste große Herausforderung für die Regierung Morales in Bolivien, weil es ohne die verfassungsmäßig vorgeschriebene Konsultation der indigenen Bevölkerung und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung in Angriff genommen wurde. Drei indigene Völker leben dort: Yuracaré, Moxeños und Chimanes. In der Tat findet die meiste Entwaldung im Umkreis von fünf Kilometern zu einer Straße statt. Im konkreten Fall befürchteten die Gegner des Projekts insbesondere ein weiteres Vordringen des Kokaanbaus und des Kokaingeschäfts im Schutzgebiet. Der oberste Drogenbekämpfer des Landes, in etwa im Rang eines Staatssekretärs, warnte beim Ortstermin vor Vereinfachungen. Das TIPNIS sei ein komplexes Universum. Siedler, unter ihnen Kokabauern, würden illegal vordringen, indigene Gemeinschaften ihren Lebensraum verteidigen. Es gebe aber auch Indígenaführer die selbst in den illegalen Export von Tropenhölzern verstrickt seien. Unlängst hätten seine Spezialkräfte im TIPNIS ein 24-stündiges Feuergefecht mit Kolumbianern gehabt, die dort ein Kokainlabor betrieben. Ich selbst war der Auffassung, dass jedenfalls das Drogengeschäft die Klandestinität suche und eine Straße eher das Vordringen der Sicherheitskräfte erleichtern würde. Das war im Jahr 2011. Triebkraft Drogenhandel Die Kokainproduktion ist für die daran beteiligten Länder sowohl ein wichtiger – wenn auch illegaler – Wirtschaftsfaktor, als auch ein ernstes gesellschaftspolitisches und ökologisches Problem. Kokablätter werden überwiegend an den Ostabhängen der Anden produziert, wo diese nach Amazonien hin abfallen. Bei der Weiterverarbeitung kommen große Mengen verschiedener Chemikalien zum Einsatz, beispielsweise rund 300 Liter Kerosin pro Kilo Kokain-Hydrochlorid. Die drei wichtigsten Produzenten haben jeweils Flächenanteile an Amazonien: Kolumbien (7 Prozent), Peru (13), und Bolivien (8), ergänzt noch durch Brasilien (59 Prozent), das eine wichtige Rolle beim Transit der fertigen Droge zu den Absatzmärkten spielt. Besonders verheerend wirkt sich die jahrzehntelang vorherrschende Politik der Vernichtung von Kokafeldern aus, teilweise durch Besprühen mit Pflanzengift aus der Luft. In Ermangelung tragfähiger Alternativen zogen die Bauern ins Hinterland und legten neue Felder an. Diese Drogenbekämpfungspolitik ohne Nachhaltigkeit brachte alljährlich tolle Ergebnisse in den Statistiken, doch unter dem Strich liegt die Koka- und Kokainproduktion nach beinahe fünf Jahrzehnten dieser Politik heute auf historischem Rekordniveau. Und während sie einerseits so erfolglos war, dass es das illegale Drogengeschäft nicht einmal nötig hatte mit der Produktion in andere Weltregionen auszuweichen* oder auf die Sorte Epadú, deren Blätter zwar weniger Kokain enthalten, die aber unter dem amazonischen Blätterdach gedeihen kann und insofern kaum aufspürbar ist, hat die Kokavernichtung ohne Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre wohl an sich schon Millionen von Hektar (Sub-) Tropischen Regenwald gekostet. Nachdem man in der internationalen Drogenpolitik langsam dabei ist, jahrzehntelang getragene Scheuklappen abzulegen und ganzheitlicher zu denken, öffnete das Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) mit seinem World Drug Report 2023 noch eine andere Perspektive: Ein ganzes Kapitel 4 ist dort der Verschränkung verschiedener krimineller Aktivitäten und der Umweltzerstörung in Amazonien gewidmet. Die Drogenökonomie, so heißt es dort, wirke als Antrieb für andere illegale Aktivitäten und Umweltzerstörung: illegale Landnahme, Abholzung, illegalen Bergbau, illegalen Handel mit Tieren und Pflanzen (Wildlife Crime). Geringe staatliche Präsenz, Armut und Korruption in Amazonien wirken als fruchtbare Nährlösung dafür und als Katalysator für Sekundärkriminalität: Steuer- und Finanzdelikte, Korruption, Totschlag, Überfälle, sexuelle Gewalt, Ausbeutung von Arbeitern und Minderjährigen sowie Gewalt, Mord und Totschlag gegenüber Umweltschützern, Menschenrechtlern und indigenen Völkern. Größer als der Umwelteffekt der Drogenproduktion an sich seien die Folgeschäden der dadurch angefachten Drogenökonomie, zum Beispiel die Anlage von Profiten in Viehzucht, Sojaanbau, im Holzgeschäft und in Goldminen, die oftmals zu Konflikten mit der indigenen Bevölkerung führen. Katalysator Gold Vor 35 Jahren durfte ich als Referent bei einer Menschenrechtsorganisation für das Volk der Yanomami kämpfen und habe dabei einen Film des bekannten Survival-Experten Rüdiger Nehberg und des Filmemachers Wolfgang Brög gegen Puristen in unserem Verband verteidigt. Die beiden hatten sich unter dem Vorwand, für einen deutschen Unterweltler Schwarzgeld investieren zu wollen, bei illegalen Goldsuchern eingeschlichen. Resultat war eine bedrückende Dokumentation über Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen sowie die Untätigkeit der zuständigen brasilianischen Regionalbehörden. Sie hatten dabei auch Yanomami gefilmt, die dies offensichtlich nicht wollten, was kritisiert worden war. Der Film war zur Hauptsendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden und ich verteidigte ihn mit dem Argument, ich könne wohl hunderte politisch korrekter Pressmitteilungen schreiben ohne ein vergleichbar großes Publikum zu erreichen. Genützt hat das alles ohnehin nichts. Die Lage ist heute schlimmer denn je. Es ist schwierig, gegen den Markt anzukämpfen. Das wissen nicht nur Drogenfahnder. Der Goldpreis hat sich seit 2008 verdreifacht. Die größten Produzenten sind China (370 Tonnen), Australien (310); Russland (310), Kanada (200), die USA (170). Erst an 6. Stelle folgt mit Mexiko (120) ein lateinamerikanisches Land, an 11. Peru (90) und an 14. Brasilien (60). Brasilien soll über einige der größten Goldvorkommen verfügen, hauptsächlich im Norden, in Amazonien, auf dem Gebiet der Yanomami. Die Goldförderung in den Andenländern und in Amazonien ist häufig illegal – geht also allenfalls indirekt in die Statistik ein – und ist mit großen Umweltverheerungen verbunden. Oft kommt dabei das giftige Schwermetall Quecksilber zum Einsatz. In Brasilien dürfte die Hälfte der Goldförderung illegal sein und findet – zum Beispiel im Yanomami-Gebiet an der Grenze zu Venezuela – unter Kontrolle der großen brasilianischen Drogenorganisationen, wie dem Primeiro Comando da Capital (PCC) statt, das den Schürfern „Schutz“ anbietet, „Steuern“ verlangt, Schürfstellen kontrolliert und manchmal Maschinen stellt und wartet. In Peru und Bolivien mischt das Comando Vermelho mit, die älteste brasilianische Drogenorganisation, die 1979 in Rio gegründet worden war. Zwischen 2011 und 2021 sei es in Brasilien zu einem Anstieg des Abbaus auf indigenen Territorien um 625 Prozent gekommen, besonders stark seit 2019. Während der Covid-19-Pandemie sei es bei abnehmenden Kontrollen und gekürzten Budgets zu einem regelrechten Goldrausch gekommen, berichtet das UNODC. Von Januar 2019 bis Dezember 2022 war dort der rechtsextreme Jair Bolsonaro Präsident, dem Indianerschutzrechte und Umweltschutz wenig und die Erschließung der „grünen Hölle“ Amazoniens viel bedeuten. Mit desaströsen Folgen, verheerenden Ausbrüchen von Unterernährung und Krankheiten. Besonders betroffen sind die Schutzgebiete der Yanomami mit etwa 30.000 Menschen. 50-90 Prozent von ihnen leiden unter Quecksilbervergiftungen unterschiedlichen Grades sowie unter der Zunahme von Gewalt. In Kolumbien, Peru und Bolivien findet man Gold häufig in den Flüssen an den Ostabhängen der Anden, wo auch die wichtigen Kokaanbaugebiete liegen. In allen diesen Gebieten ist ein signifikanter Anstieg der Mord- und Totschlagsraten festzustellen. Der Preis für einen Barren (ein Kilogramm) liegt mit rund 82.000 € rund doppelt so hoch wie der für ein Kilo Kokain zu Großhandelspreisen in europäischen Metropolen. Wobei mit Kokain im Straßenverkauf dann doch noch weit höhere Preise erzielt werden. Gold stinkt nicht. Im Vergleich zu Kokain ist es viel leichter verkehrsfähig. Ideal zur Geldwäsche. Kolumbien – Ecuador – Connection Machtvolle Drogenorganisationen sind besonders im Dreiländereck zwischen Brasilien, Kolumbien und Peru aktiv, einschließlich in und um die benachbarten Städte Leticia in Kolumbien und Tabatinga in Brasilien sowie Santa Rosa de Yavarí in Peru. Mit ihrer Kontrollfunktion für das Kokaingeschäft und dem Reichtum an ausbeutbaren Ressourcen weist diese Region heute möglicherweise die höchste Dichte von Gruppen der Organisierten Kriminalität auf, vermutet das UNODC. Menschenrechtsorganisationen beziffern die Mord- und Totschlagsrate in Tabatinga mit 106,6, in Leticia mit 60 und in Manaus mit 45 (pro 100.000 Einwohnern; in Deutschland liegt sie bei 0,8, in Österreich bei 0,9). Nördlich davon fließt der Río Putumayo, der weiter östlich in den Amazonas mündet und im Oberlauf über hunderte von Kilometern die Grenze zwischen Kolumbien und Peru beziehungsweise Ecuador bildet. Der Vektor des Kokaingeschäfts verläuft hier stromaufwärts nach Ecuador, das Anfang 2024 in einer Welle der Gewalt versank, weil sich dort die Statthalter mexikanischer Organisationen blutige Revierkämpfe lieferten. Ein Vierteljahrhundert militarisierter Drogenkrieg und Milliarden von US-Hilfen im Rahmen des Plan Colombia haben nichts daran geändert, dass laut dem World Drug Report des UNODC 230.028 Hektar Koka (von insgesamt rund 300.000) in Kolumbien angebaut werden und nach wie vor auch etwa zwei Drittel der Kokainlabore in Kolumbien entdeckt und zerstört werden – fast die Hälfte davon in den südlichen Departments Putumayo und Nariño im Grenzgebiet zu Ecuador. Die Verlagerung des Kokaanbaus in den Süden wird ebenso als Konsequenz des Plan Colombia angesehen wie der Friedensprozess mit der ältesten Guerilla, den 1964 gegründeten Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vor einem Jahrzehnt. Präsident Juan Manuel Santos bekam dafür im Oktober 2016 den Friedensnobelpreis. Der Friedensplan wurde jedoch nur halbherzig vollzogen. Nachfolger Iván Duque lehnte ihn ab. Hunderte früherer Guerillakämpfer, die ihre Waffen abgelegt hatten, wurden später ermordet. Verschiedene ihrer frentes (Fronten i.S. von Abteilungen) , die große Autonomie genossen , hatten sich schon vorher mit dem Drogengeschäft finanziert und machten einfach weiter. Letztlich gelang es dem kolumbianischen Staat nicht, in den früheren Guerillagebieten rechtsstaatliche Präsenz zu schaffen. Durch den Einsatz verbesserter Sorten und Anbaumethoden soll die Ernte nach Berechnungen des UNODC um durchschnittlich 24 Prozent angestiegen sein und durch Optimierung der Weiterverarbeitung auch der Kokainertrag. Solche neuen Hochproduktivitätszonen befinden sich unter Kontrolle rechter Narcoparamilitares , FARC-Dissidenten beziehungsweise des noch aktiven Ejercito de la Liberación Nacional ( ELN ) , einer weiteren Guerilla. Alle zusammen werden sie Grupos Armados Ilegales ( GAI ) genannt. 35 Prozent der Kokaanbaufläche Kolumbiens befinden sich in Zonen, in denen GAI präsent sind. Diese arbeiten fallweise zusammen oder bekriegen sich. Aber alle sind um strikte Kontrolle des Produktionsprozesses bemüht. Im Department Putumayo lassen sich sechs Gruppen identifizieren, die nahezu umfassende Kontrolle ausüben. Die größten sind ehemalige f rentes der FARC , das Comando Frontera und die Frente Carolina Ramírez – und sie bekämpfen sich. Amazon Underworld Im Rahmen des 20. Treffens der Mitgliedsstaaten der UN Konvention gegen das Organisierte Verbrechen treffe ich im Herbst 2024 den NGO-Vertreter Raphael Hoetmer und zwei Indígena-Vertreter aus dem peruanischen Amazonien, die ihre Namen besser nicht veröffentlicht wissen wollen. In ihre Heimatdörfer trauen sie sich nicht zurück. Das Hauptproblem dort sei der Kokainhandel, erzählen sie. Die drei sind in die Wiener UNO-City gekommen, um das Projekt Amazon Underworld vorzustellen, an dem mehrere NGOs und Investigativjournalisten teilgenommen haben. Amazon Underworld machte unter anderem mit Interviews von Behördenvertretern, Sicherheitskräften, Indígenas und verschiedenen illegalen Akteuren vor Ort dort weiter, wo der UN-Bericht aufhört, um zu einem kompletteren Bild der Dynamik des Geschehens zu kommen. In ihrem Bericht erscheint Amazonien als Karte, in der die Grenzgebiete von Brasilien, Französisch Guayana, Surinam, Venezuela, über Kolumbien, Ecuador, Peru bis Bolivien und Paraguay von einem dicken Halbmond verschiedener illegaler Aktivitäten und Akteure umgeben sind. Aus der Nähe besehen handelt es sich dabei um einen bunten Flickenteppich krimineller Akteure; selten besteht Hegemonie, häufig gibt es Konflikte. In 70 Prozent der untersuchten Gemeinden waren irreguläre bewaffnete Gruppen präsent: kolumbianische Guerillas, brasilianische kriminelle Organisationen, venezolanische und peruanische Banden, nicht selten auch unter Duldung oder in Komplizenschaft mit den lokalen Behörden. Dabei komme es auch zu Fällen moderner Sklaverei und Menschenhandel. Die dort lebenden indigenen Gemeinschaften und ihre Territorien spielen eine fundamentale Rolle beim Schutz der Regenwälder und sind gleichzeitig den Attacken der Organisierten Kriminalität ausgesetzt. Im letzten Jahrzehnt, so der Bericht in der Einleitung, sei Amazonien zu einer der gefährlichsten Regionen Lateinamerikas geworden und die marginalisierten Gemeinschaften litten am meisten unter der Gewalt. In Brasilien seien indigene Gemeinden systematisch zum Opfer gewalttätiger Invasionen von Goldsuchern geworden, während man in den neun amazonischen Departments Kolumbiens seit 2020 43 Massaker dokumentiert habe und bewaffnete Gruppen die ländlichen Gemeinden terrorisierten. In Peru rekrutieren Drogenhändler indigene Kinder, um in den Kokapflanzungen zu arbeiten. Guerillagruppen schicken ganze Familien in die illegalen Goldminen. Laut der Menschenrechtsorganisation Global Witness sei einer von fünf Morden, die im Jahr 2022 weltweit gegen Umweltschützer oder Verteidiger ihres Territoriums verübt wurden, in Amazonien geschehen, nämlich 39. Rember Yahuarcani aus dem Volk der Huitoto im peruanischen Amazonien wies auf der Biennale 2024 in Venedig in einem seiner farbenfrohen Großgemälde (Titelbild) darauf hin, dass dort zwischen 2013 und 2023 insgesamt 32 indigene Führer und Führerinnen von Eindringlingen, Drogenhändlern und der Holzmafia ermordet wurden. Ihre amazonische Heimat sei für Indigene einer der gefährlichsten Orte. Eine entscheidende Rolle spielen Straßen. Wie erwähnt, findet die meiste Entwaldung im Umkreis von fünf Kilometern zu einer Straße statt – und in Amazonien entfallen auf einen legalen Straßenkilometer drei illegale. Aber auch andere Infrastruktur erleichtert das Vordringen: illegale Landepisten, desgleichen Flüsse, bevorzugt zur Regenzeit. In Gegenden, wo indigene Territorien fragmentiert, von Straßen durchschnitten oder wirtschaftlich und sozial sehr von städtischen Märkten abhängig sind, wachsen illegale Märkte rasch und machen die indigenen Völker sehr verwundbar, mit der Gefahr einer Desintegration ihrer Gemeinden. In den peruanischen Departments Ucayali und Madre de Dios beispielsweise, wo alle sozialen und politischen Aktivitäten sich mit der illegalen Ökonomie überlappen und sich gegenseitig unterstützen, werden die indigenen Gemeinden dieser Dynamik unterworfen, und wenn sie in der Lage sind Widerstand zu leisten, werden sie bis zu dem Punkt isoliert, dass der Zugang zu ihrem Territorium gefährdet ist. Der Preis, den indigene Organisationen und ihre Führer bezahlen, ist sehr hoch. Sie sind mit Drohungen gegen sich und ihre Familien konfrontiert. Fälle von Gewalt gegen sie werden häufig nicht gut untersucht und bleiben straflos, warnt Amazonia Underworld. Panorama der kriminellen Akteure Das Jahr 2016 brachte in mehrfacher Hinsicht neue kriminelle Dynamiken. Das Friedensabkommen mit der ältesten Guerilla des Halbkontinents, den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), führte dazu, dass Tausende ihre Waffen niederlegten. Die Guerilla hinterließ vielerorts ein Machtvakuum, das nicht mit rechtsstaatlicher Präsenz gefüllt wurde, sondern von rechtsextremen Paramilitärs, kriminellen Banden und FARC-Dissidenten. In Venezuela wurde 2016 ein Gesetz zur Erschließung des Grenzgebiets zu Kolumbien, Brasilien und Guyana verabschiedet, des sogenannten Arco Minero Orinoco . Doch die Regierung Maduro ließ keine Initiativen zur Erschließung durch legalen Bergbau folgen. Das Vakuum füllten venezolanische kriminelle Gruppen, häufig in Kooperation mit lokalen Behörden und Sicherheitskräften, aber auch FARC-Dissidenten und ELN-Guerilleros, die schon länger beim Drogentransit in Venezuela tätig waren. Ebenfalls 2016 wurde auch ein Pakt zwischen drei großen brasilianischen Gruppen der Organisierten Kriminalität aufgekündigt: dem Primero Comando da Capital , dem Comando Vermelho und der Familia do Norte , was zu Revierkämpfen führte. Mit Kleinkriminellen überfüllte Gefängnisse bildeten eine ideale Rekrutierungsquelle. Die kolumbianische ELN hat eine strategische Präsenz zu beiden Seiten der venezolanischen Grenze. Sie kontrolliert die illegale Goldförderung in den venezolanischen Bundesstaaten Amazonas, Bolívar und Delta Amacuro, wie auch die Routen des Drogenhandels nach Guyana und Brasilien entlang des Cayuní-Flusses und des Río Negro. Die FARC hatten historisch eine starke Präsenz im kolumbianischen Amazonien, wo sie die Entwaldung begrenzten, weil sie den Schutz des Blätterdaches suchten. FARC-Dissidenten tun dies wieder. Die Entwaldung ist 2022/23 in den Departments Meta, Caquetá und Guaviare drastisch zurückgegangen. Dort operieren La Segunda Marquetalía (unter Luciano Marín Arango alias Iván Marquez) und Estado Mayor Central – FARC (unter Néstor Gregorio Vera Fernandez alias Iván Mordisco). In Venezuela arbeitet die Frente Acacio Medina im Drogentransfer. Das Primero Comando da Capital (PCC) wurde 1993 im Gefängnis in São Paulo gegründet und ist inzwischen das wichtigste Drogenunternehmen Brasiliens. Traditionell wurden Drogen aus Bolivien und Peru über Paraguay importiert. Mittlerweile ist das PCC auch ins Grenzgebiet zu Venezuela expandiert, wo es über 2.000 Mann verfügen soll und Drogengewinne in die Goldförderung steckt. Verschiedene Quellen berichteten Amazon Underworld, dass das Engagement des PCC dort Supervision, Steuererhebung sowie Dienstleistungen einschließlich Bordellen umfasst. Das Comando Vermelho (CV) ist das älteste Drogenunternehmen Brasiliens. Es wurde 1979 in Rio gegründet und ist in Paraguay und Kolumbien aktiv sowie neuerdings auch in Bolivien und Peru. Die Familia do Norte (FDN) als Drogenorganisation mit Sitz in Manaus wurde in der zweiten Hälfte der Nullerjahre im Zuge von Auseinandersetzungen weitgehend zerrieben und ist teilweise im CV aufgegangen. In Ecuador bekriegen sich Los Lobos und die Choneros , die im Drogenexport tätig sind und jeweils mit unterschiedlichen mexikanischen Organisationen Beziehungen unterhalten. Schlussfolgerungen Amazonien wird im Zusammenhang mit der Klimakrise und einem möglichen ökologischen Kipppunkt diskutiert. Doch bis zu welchem Punkt muss Amazonien vom Organisierten Verbrechen durchdrungen sein um zu sagen, dass die illegalen Ökonomien die Oberhand haben? In manchen Regionen übersteigen die Gewinne aus illegalen Geschäften bereits die behördlichen Budgets. Mit schwacher Präsenz und geringen Mitteln ist der Kampf dagegen ein Ding der Unmöglichkeit, resümiert der Bericht von Amazon Underworld. Seine Empfehlungen beziehen sich auf Kooperation und Informationsaustausch, Stärkung der Grenzsicherheit. Whistleblower und Zeugen müssten geschützt und Korruption bekämpft werden. Die Drogenfahndung einschließlich der zu ihrer Herstellung benötigten Chemikalien sollte intensiviert werden. Umweltprobleme und Gewaltakte sollten in einer grenzüberschreitend zugänglichen Datenbank unter besonderer Berücksichtigung der Erfassung Organisierter Kriminalität dokumentiert werden. Generell sei ganzheitliches Denken erforderlich. Umweltprobleme und Sicherheitsfragen müssten zusammen gedacht werden, Umweltschutzkonferenzen und Sicherheitskonferenzen zusammengeführt. Besonders wichtig sind der Schutz und die Stärkung indigener Gemeinschaften. Der Bericht empfiehlt ferner die Ausweisung grenzüberschreitender Schutzgebiete. Immerhin ein Lichtblick: Mit Gustavo Petro (Kolumbien) und Lula da Silva (Brasilien) haben sich die Präsidenten der wichtigsten Staaten Amazoniens – was Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft betrifft – zu mehr Schutz und Zusammenarbeit bekannt. Www.amazonunderworld.org www.infoamazonia.org www.amazonwatch.org * Koka kann überall dort gedeihen, wo auch Kaffee wächst; so war holländisch Indonesien einstmals ein wichtiger Produzent.
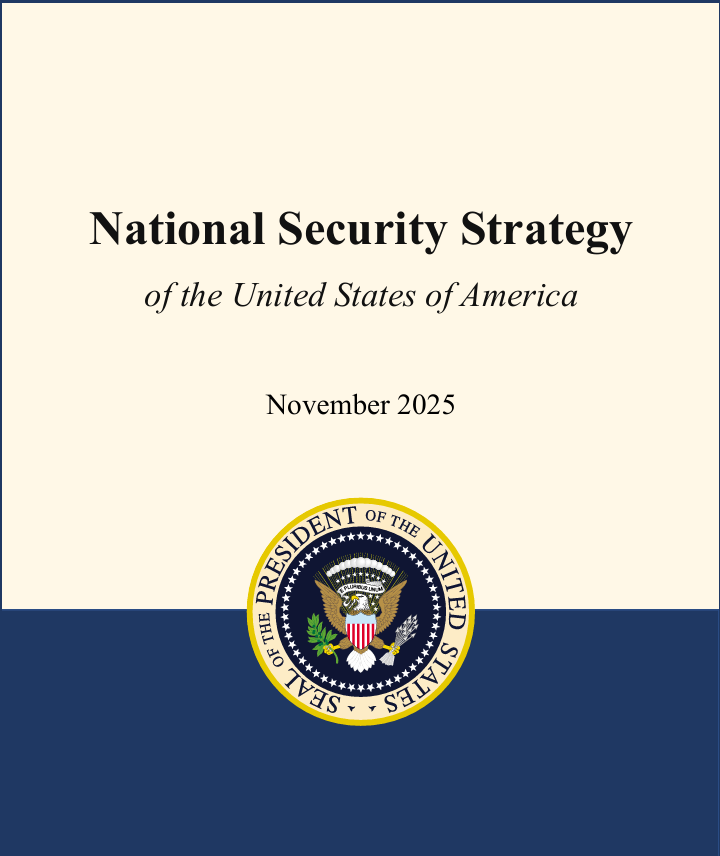
Aus europäischer Sicht mag man darüber spekulieren, ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trumpschen National Security Strategy am 4.12. mit der dreistelligen Millionenstrafe gegen Elon Musks Plattform X (verkündet am 5.12.) durch die Europäische Union zu tun hat. Eine ähnliche Strafe hat es ja bereits im September gegen Google gegeben. Weitere Verfahren gegen US Tech-Giganten – eine Kapitalfraktion, deren Eigentümer zu den reichsten Männern der Welt und den wichtigsten Unterstützern von The Donald gehören – sind in Brüssel anhängig. Vorwürfe über Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Demokratie werden als Umkehr der Tatsachen wahrgenommen und zurückgewiesen, denn sie finden ja gerade unter der Trump-Regierung statt sowie bei deren besonders engen Freunden in Europa. Eine Überempfindlichkeit angesichts der globalen Reichweite des gesamten Papiers einerseits und seiner begrenzten praktisch-politischen Bedeutung als Richtschnur andererseits? National Security Strategies hat es schon viele gegeben: G.W. Bush 2002 und 2006, Obama 2010 und 2015, Trump I 2017, Biden 2021 und 2022. Eine zunehmende Häufigkeit im 21. Jahrhundert mag mit der Volatilität der Weltlage zusammenhängen. Die vorliegende Strategy ist mit 33 Seiten – inklusive Deckblatt und Vorwort – vergleichsweise sehr kurz und pamphlethaft. Seit dem unverschämten Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar sind die Vorwürfe an Europa ja hinlänglich bekannt. Nun hat man es auch noch schwarz auf weiß. Von wirtschaftlichem Niedergang, dem Verlust von Selbstvertrauen und der "starken Gefahr einer zivilisatorischen Auslöschung“ ist da die Rede. Es sei fraglich, ob Europa ein verlässlicher Verbündeter bleibe. Im Zentrum der Kritik steht in der Tat die Europäische Union mit ihrer Regulierungswut sowie multilaterale Regulierungen überhaupt: „The larger issues facing Europe include activities of the European Union and other transnational bodies that undermine political liberty and sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating strife.“ Schon einleitend heißt es unter ‚Prinzipien‘: „We will oppose elite-driven, anti-democratic restrictions of core liberties in Europe, the Anglosphere, and the rest of the democratic world, especially among our allies.“ Und: „We reject the disastrous ‚climate change‘ and ‚Net Zero‘ ideologies that have so greatly harmed Europe, threaten the United States, and subsidize our adversaries.“ Eine Scheidungsurkunde also, wie manche Kommentatoren meinen? Schlimmer! Ein Adoptionsangebot, verbunden mit einer Kriegserklärung gegen universelle Werte wie Menschenrechte, Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat sowie ihre multilateralen Wächter. Europa: „Promoting European Greatness“ Nach allgemeinen Darlegungen zu Zielen, Prinzipien, Strategien und Werkzeugen folgen in der zweiten Hälfte des Papiers die Weltregionen. Der Abschnitt zu Europa ist mit ‚Förderung seiner Größe‘ überschrieben, was wohl nicht als Ausdehnung des Gebiets zu verstehen ist, sondern im Sinne von Großartigkeit. Europa bleibe „strategically and culturally vital to the United States“ . Europa abzuschreiben wäre selbstzerstörerisch. Und: „…the growing influence of patriotic European parties indeed gives cause of great optimism.“ Elon Musks offensive Parteinahme für die deutsche AfD im Wahlkampf kommt da in Erinnerung. Angestrebt ist demnach eine Partnerschaft mit einem Europa der Orbans und Ficos, der AfD und der FPÖ, der PiS, der VOX und des Rassemblement National. Übrigens: Russland wird nur in zwei Absätzen mit seinem Verhältnis zu Europa erwähnt, ansonsten in der ganzen Strategie nicht. In der Tat steht Putin weltanschaulich und gesellschaftspolitisch Trump ja näher als etwa Macron, Starmer oder Sánchez. Beider Denken geht mitunter hinter die Aufklärung zurück. Russland erscheint als wirtschaftlich irrelevant und als keine strategische Bedrohung wahrgenommen zu werden. Die Vision: Eine Welt souveräner Nationalstaaten unter einem starken Führer Auch ansonsten gibt es große Übereinstimmungen in Weltsicht und Selbstbild, angefangen mit der Selbstüberhöhung. Idealbild ist, ähnlich wie bei den Identitären, eine Welt souveräner und kulturell homogener Nationen, die konkurrieren und kooperieren, frei von supranationalen Regulierungen und nach dem Gesetz des Stärkeren. Eine solche Ordnung der Welt sei gottgegeben, Multilateralismus erscheint implizit quasi als Teufelswerk. Die gesamte Strategie ist vom Gedanken an eine natur- oder gottgegebene Überlegenheit der USA als gods own country oder manifest destiny durchtränkt, die teilweise wiederhergestellt werden müsse. An verschiedenen Stellen beruft sie sich auf Gott. Noch häufiger erscheint der Name Trump. „Over the past nine months, we have brought our nation – and the world – back from the brink of catastrophe and disaster. After four years of weakness, extremism, and deadly failures, my administration has moved with urgency and historic speed to restore American strength at home and abroad, and bring peace and stability to our world. No administration in history has achieved so dramatic a turnaround in so short a time. (…) „America is strong and respected again – and because of that, we are making peace all over the world.“ So messianisch beginnt das Vorwort des Präsidenten. Von Russland war bereits die Rede. Einen weiteren Hinweis auf geopolitische Gewichtungen gibt die Länge der jeweiligen Kapitel, wobei Europa mit zweieinhalb Seiten nach Asien und Lateinamerika erst an dritter Stelle kommt, vor Nahost mit zwei und Afrika mit einer halben Seite. Der Nahe Osten erscheint als eine von der Trump-Administration weithin befriedete Region, wo auf der arabischen Halbinsel exzellente Geschäfte winken. Die Rede ist tatsächlich von Frieden, nicht von einem fragilen Waffenstillstand, der täglich gebrochen wird und Todesopfer fordert. Die jeweiligen Regierungs- und Gesellschaftssysteme und ihre Entwicklung solle man dort sich selbst überlassen – im Gegensatz zu Lateinamerika, aber dazu später. Reformen könne man freilich begrüßen. Das gilt auch für die Menschenrechte und offenbar auch für Herrscher, die kritische Journalisten foltern und ermorden lassen. Als geopolitischer roter Faden zieht sich die Eindämmung Chinas durch das ganze Dokument, nicht zuletzt durch das mit sechs Seiten längste, das Asienkapitel. Hier geht es um Marktanteile, legitimen oder unlauteren Wettbewerb und in geostrategischer Hinsicht um die freie Schifffahrt nicht nur im Südchinesischen Meer und um Taiwan, wobei auch hier die Verbündeten einen größeren Eigenbeitrag leisten müssten. Als solche werden ausdrücklich Europa, Japan, Korea, Australien, Kanada und Mexiko genannt. Indien solle hinzugewonnen werden. Um die Zurückdrängung Chinas geht es auch im zweitlängsten Kapitel, dem zu Lateinamerika: „Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine“ Die Überschrift lässt keinen Zweifel daran, worum es geht. Die Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823 definierte Lateinamerika als exklusive Einflusszone der USA und war – keine fünfzig Jahre nach der eigenen Unabhängigkeitserklärung – gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet. Mit der Roosevelt-Corollary (Zusatz) von 1904 behielt sich Washington eine Schiedsrichterrolle bei inneramerikanischen Konflikten und ein exklusives Interventionsrecht vor, wie es bereits in der ersten Verfassung Kubas von 1902 festgeschrieben worden war, das nach dem Sieg im Spanisch-Amerikanischen Krieg den USA zugefallen war. Die Überschrift des Lateinamerika-Kapitels unterstreicht, dass man an diese Tradition anknüpfen will, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Fortsetzung in der containment policy fand, der Eindämmung des „Kommunismus“ - und nach der Revolution von 1959 vor allem Kubas. Unter Marco Rubio, dem Außenminister mit kubanischen Wurzeln, geht es mit anderen Begrifflichkeiten weiterhin darum, vordergründig jedoch um Sicherheit. Nicht im Sinne einer Invasion fremder Truppen über die südliche Landesgrenze, sondern um Migration und Drogen. Darüber hinaus und vor allen Dingen aber geht es um die Zurückdrängung Chinas, den Zugriff auf Rohstoffe und die Schwächung unliebsamer Regierungen, die diesen erschweren. „After years of neglect, the United States will reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere, and to protect our homeland and our access to key geographies throughout the region. We will deny non-Hemispheric competitors the ability to position forces or other threatening capabilities, or to own or control strategically vital assets, in our Hemisphere. This ‚Trump Corollary‘ to the Monroe Doctrine is a common-sense and potent restoration of American power and priorities, consistent with American security interests.“ Dass auswärtige Wettbewerber, zum wirtschaftlichen und strategischen Nachteil der USA, bedeutenden Zutritt zur Region gewinnen konnten, ohne dass sie ernsthaft zurückgedrängt wurden, sei ein großer strategischer Fehler gewesen. „The terms of our alliances, and the terms upon which we provide any kind of aid must be contingent on winding down adversarial outside influence – from control of military installations, ports, and key infrastructure to the purchase of strategic assets broadly defined.“ Die Botschaften der USA sollen sich der Förderung von Geschäftskontakten widmen. „At the same time, we should make every effort to push out foreign companies that build infrastructure in the region.“ Das bezieht sich wohl insbesondere auf den neuen Megahafen in Chancay bei Lima in Peru, der von der chinesischen COSCO gebaut und unlängst eröffnet wurde. Die USA wollen Partner „erster Wahl“ sein … „and will (through various means) discourage their collaboration with others.“ Die Länder der Hemisphäre hätten die Wahl zwischen einer „American-led world of souvereign countries and free economies or a parallel one in which they are influenced by countries on the other side of the world.“ Unter anderem solle auch die Militärpräsenz überdacht werden, was bedeute: „A readjustment of our global military presence to adress urgent threats in our Hemisphere, especially the missions identified in this strategy, and away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years." (Anm. R.L.: siehe die Verlegung der USS Gerald Ford, des größten US Flugzeugträgers, vom Mittelmeer in die Karibik.) (…) „Targeted deployments to secure the border and defeat cartels, including where necessary the use of lethal force to replace the failed law enforcement -only strategy of the last several decades; and Establishing or expanding access in startegically important locations.“ Bereits im einleitenden Teil des Strategiepapiers wird unter ‚Prinzipien‘ deutlich gemacht, dass zwar die Gründerväter in der Unabhängigkeitserklärung den Vorzug für Interventionsverzicht niedergelegt hätten. Aber: „For a country, whose interests are numerous and diverse as ours, rigid adherence to non-interventionism is not possible.“ Die ersten Monate der Trump-Administration gaben reichlich Beispiele dafür, wie man sich das in der Praxis vorzustellen hat: Vom Druck auf die Regierung Panamas, weil ein chinesisches Unternehmen den Ausgang des Panama-Kanals kontrolliere; über Interventionsdrohungen gegen die Regierung Claudia Sheinbaum in Mexiko, damit diese Grenzkontrollen und Drogenbekämpfung intensivieren und militarisieren solle; zu Bestrebungen, den Luftwaffenstützpunkt Manta in Ecuador wieder zu nutzen (was bei einem Referendum von der Wählerschaft zurückgewiesen wurde); über die flagranten Einmischungen in die brasilianische Justiz im Fall des Putschisten Jair Bolsonaro und in die Wahlen in Honduras; bis zum beispiellosen Militäraufmarsch vor der Küste Venezuelas und der Versenkung angeblicher Drogenschnellboote auf offener See, die rein gar nichts zur Linderung der Drogenprobleme in den USA beitragen wird. Letztere bezeichnet der UNO Hochkommissar für Menschenrechte als völkerrechtswidrig und der UN Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismus, der australische Völkerrechtler Professor Ben Saul, spricht von Mord, weil weder eine militärische, noch eine terroristische Bedrohung und schon gar kein Krieg – also auch kein Kriegsverbrechen – vorliege. „Legalität ist eine Machtfrage“ hat Ulrike Meinhof gesagt. Ist es zulässig, eine Terroristin zu zitieren? Vielleicht, wenn es um Terrorismus geht, um die Frage, ob es sich – wie von der Trump-Administration behauptet – um „Narcoterrorismus“ handelt oder um „Staatsterrorismus“. Es muss nicht wirklich verwundern, wenn bei schwierigeren Bedingungen für die Kapitalakkumulation, schärferer Weltmarktkonkurrenz, knappen Rohstoffen und multiplen Krisen Vernunft und gute Sitten über Bord geworfen werden, wenn bellizistische Rhetorik üblich wird, wenn Völker- und Menschenrecht dem Feuilleton überlassen bleiben. Bemerkenswert ist, dass es sich im vorliegenden Papier vielfach um die pseudo-konzeptionelle Untermauerung der realen politischen Praxis handelt, statt um eine Strategie für die Zukunft. Mehr als alles andere wird die Großartigkeit der Vereinigten Staaten und ihres aktuellen Präsidenten beschworen. Anders als im vorliegenden Dokument stehen sich im realen Leben nicht einfach Nationalstaaten gegenüber. Noch gibt es auch in den Vereinigten Staaten eine Opposition, zivilgesellschaftliche Organisationen, unterschiedliche veröffentlichte Meinungen. Der diesseits des Atlantiks üblich gewordene Kotau gegenüber Trump und seiner Regierung ist nicht einfach nur peinlich. Er lässt ihn zuhause erfolgreich dastehen und stärkt ihm den Rücken gegenüber seinen Kritikern. Ob die Lateinamerikaner – Progressisten oder Konservative – von der ihnen zugedachten Rolle als Arena des Ringens zweier Großmächte oder schlicht als Untergebene begeistert sein werden? Bisher gibt es kaum Reaktionen. Interessant ist ferner, was nicht in der Strategie steht: Von einer Einverleibung Kanadas ist so wenig die Rede wie vom Kauf Grönlands. Übrigens: Es gibt auch durchaus richtige Wahrnehmungen und bedenkenswerte Einschätzungen in dem Dokument, das einmal mehr Einblick in die Denkweise seiner Väter gibt. Die darin zum Ausdruck gebrachte Weltsicht ist gefährlich anachronistisch. https://www.whitehouse.gov/up-content/uploads/2025/2025-National-Security-Strategy.pdf
Der Wahlsieg war mit 54:45 Prozent in der Stichwahl ebenso überzeugend wie insgesamt überraschend. Rodrigo Paz Pereira ist auf der großen politischen Bühne seines Landes ein Newcomer. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 17. August hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Seine politische Karriere begann er im Jahr 2002 als Abgeordneter des Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Bewegung der Revolutionären Linken - MIR), das sein Vater, Jaime Paz Zamora (später 60. Präsident von 1989 bis 1993), im Jahr 1971 während der Zeit der Militärdiktaturen im chilenischen Exil mitbegründete. Zwischen 2015 und 2020 war Paz Pereira Bürgermeister seiner Heimatstadt Tarija und ab 2020 Senator von Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadana . Nun gewann er auf dem Ticket der bisher bedeutungslosen Christdemokratischen Partei (PDC) zunächst mit 32,06 Prozent der Stimmen vor dem zweiten Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre ) mit 26,7 Prozent. Die Linke, die mit dem Movimiento al Socialismo (MAS) in den letzten zwei Jahrzehnten seit 2005 stets absolute Mehrheiten erzielt hatte, ist zersplittert und in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. (Wir berichteten in diesem Blog: "Bolivien: Totalschaden für die Linke" und frühere Beiträge.) Das heißt auch: Im Parlament wird sich die neue Regierung Mehrheiten suchen müssen. Der ursprünglich favorisierte Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad ), der unter Vater Jaime Paz einmal Minister war, landete auf dem dritten Platz und hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt. Ebenso wie der in Umfragen vor der Stichwahl ebenfalls favorisierte klare Verlierer „Tuto“ Quiroga (54:45 Prozent). Alle drei „Parteien“ sind rechts der Mitte zu verorten. Zusammen kämen sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Vergangenheit hatte bei Bedarf die US-Botschaft solche Allianzen geschmiedet. „Kapitalismus für alle…“ …lautet Paz‘ Versprechen. Bolivien ist ein Land ohne Kapitalisten (sprich: unternehmerische Tradition). Bis 1952 beherrschten drei Zinnbarone die wirtschaftlichen und politischen Geschicke. Nach der Revolution von 1952/53 folgte eine Periode des Staatskapitalismus, die politisch unter anderem deshalb scheiterte, weil sich mit Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce und Juan Lechín mehrere Caudillos um die Kontrolle des regierenden Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) stritten. Eine Parallele zur Aktualität: Um die MAS und ihr Erbe stritten sich vor ihrem Niedergang Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez und Eduardo del Castillo. Seinerzeit folgten von 1964 bis 1982 lange Jahre teilweise blutiger Militärdiktaturen. Der Staatskapitalismus dauerte an. Ihm folgte ab 1982 eine gewählte Linksregierung, die 1986 an einer Hyperinflation zerbrach. Der Führer der Revolution von 1952, Víctor Paz Estenssoro, gewann die Wahlen und leitete eine neoliberale Strukturanpassung nach Vorgaben des IWF ein, die bei hohen sozialen Kosten makroökonomische Stabilisierung brachte. Für die maroden Staatsbetriebe wollte sich aber fast ein Jahrzehnt lang kein Käufer finden, bis sie in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Sonderkonditionen überwiegend an ausländische Investoren verhökert wurden. Bolivien wurde zum Aid Regime, ausländische „Entwicklungshilfe“ zum Akkumulationsersatz. Das interne Steueraufkommen reichte oft nicht einmal aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Ein Jahrzehnt später war das Modell gescheitert und die MAS übernahm im Januar 2006 nach einem Erdrutschsieg das Ruder. Das Wirtschaftsmodell soll heute also weniger staatszentriert sein und mehr auf Marktwirtschaft und Privatinvestitionen setzen. Vor allem aber wird es auf Auslandsfinanzierung angewiesen sein. In der Ministerriege fallen erfahrene Technokraten auf. Einige haben für die Vereinten Nationen gearbeitet, andere waren vor 2006 schon einmal Minister. Die Umstellung dürfte weniger rabiat erfolgen als unter der selbsternannten Interimsregierung, die nach der Machtergreifung der Rechten im November 2019 ein Jahr lang nach Kräften versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder auch unter Quiroga, der bereits unter dem Exdiktator Hugo Banzer (1997-2001) einmal als Vizepräsident und nach dessen Krebstod ein Jahr lang bis 2002 auch als Präsident einen strikt neoliberalen Kurs fuhr. Leicht wird es nicht werden. Die Kassen sind leer und das Land leidet seit Monaten unter Treibstoff- sowie Devisenknappheit. Gleich am Tag nach der Amtseinführung konnte der neue Präsident einen Lkw-Konvoi mit hunderten von Zisternen voll Treibstoff begrüßen. Erinnerungen an Chile 1973 drängen sich auf. Eine erste Auslandsreise hatte den designierten Präsidenten schon vorher nach Washington geführt, von wo er Kreditzusagen (die Rede ist von sechs Milliarden US-Dollar) mitbrachte sowie eine Vereinbarung, umgehend wieder diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Zur Erinnerung: Präsident Morales hatte diese nach dem Zivilputsch vom September 2008 abgebrochen; zur Jahrtausendwende entsprachen ausländische „Entwicklungshilfen“ jeweils etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Amtseinführung waren Vertreter Nicaraguas, Venezuelas, Kubas und des Iran ausdrücklich nicht eingeladen. Ein deutliches Zeichen für den Kurswechsel in der Außenpolitik. Ohne Basis, Programm und Struktur Die PDC ist eine Partei ohne Programm und ohne Basis. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt aber ein Spiegelbild der bisherigen Polarisierung. Paz gewann die Stichwahl in sechs von neun Departements (in La Paz, Cochabamba, Potosí und Oruro mit mehr als 60 Prozent). Quiroga gewann in den Tieflanddepartements Santa Cruz und Beni; nahezu gleichauf lagen beide in Tarija. Darin zeigt sich noch einmal die Tragik des politischen Versagens der MAS. Deren frühere Wählerinnen und Wähler im Hochland entschieden sich nun doch eher für die moderate Rechte, zumal der Vizepräsidentschaftskandidat von Libre , Juan Pablo Velasco, wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen war. Damit ist nicht gesagt, dass die neue Regierung auch auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Wählerklientel eingehen wird. Bei der konnte nicht zuletzt der nunmehrige Vizepräsident Edmand Lara punkten, ein Polizist, der aus dem Dienst entlassen worden war, nachdem er Polizeikorruption angeprangert hatte. Der erklärte Bewunderer des salvadorianschen Präsidenten Nayib Bukele erwarb sich so einen Ruf als unbestechlicher Korruptionsbekämpfer und besticht selbst durch fleißiges Posten populistischer Äußerungen auf TikTok. Seinen Amtseid legte er in Polizeiuniform ab. Es gibt Beobachter die meinen, mit ihm als Spitzenkandidat hätte die PDC im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen können. Dementsprechend fällt Lara durch großes Selbstbewusstsein und Ambitionen auf, beklagt mangelnde Kommunikation von Paz mit ihm und betont bei jeder Gelegenheit, er würde in der Regierung nicht fünftes Rad am Wagen sein. Möglich, dass Lara sich als stärkste Oppositionskraft in der eigenen Regierung herausstellt. Übrigens: Laras Frau wurde – wie Quirogas Schwester – schon im ersten Wahlgang auf einem sicheren Listenplatz Abgeordnete. Kapitalismus für alle, das Versprechen dürfte sich neben ausländischen Investoren vielleicht noch für eine neue Mestizo-Bourgeoisie erfüllen, die gestärkt aus dem proceso de cambio der MAS-Jahre hervorgegangen ist. Sie sorgt sich um ihr kürzlich erworbenes Vermögen, scheut staatliche Kontrolle und Interventionismus, möchte aber auch nicht gänzlich auf Regulierung verzichten. Die Umverteilungspolitik der MAS beruhte auf dem Export von Erdgas und Erdöl, auf Extraktivismus, und war von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten abhängig. Die Erschließung neuer Quellen hatte man vernachlässigt, auf Diversifizierung lange verzichtet. Obwohl Bolivien wahrscheinlich auf den weltweit größten Lithiumvorkommen sitzt und man von Anfang an gute Konzepte hatte – nicht nur den Rohstoff wollte man exportieren, sondern zumindest Batterien – ist auch dabei nichts Zählbares weitergegangen. Nachdem sich die Europäer 2019 selbst aus der Poleposition geschossen hatten, auch nicht mit zuletzt chinesischen und russischen Partnern. Die Herausforderungen sind groß. Der informelle Sektor ist weiter angewachsen. 85 Prozent der Menschen sollen ganz oder teilweise auf ihn angewiesen sein. Das Budgetdefizit lag 2024 bei 10,62 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jährlich wiederkehrende Großfeuer und die Vergiftung von Flüssen durch Goldsucher stellen große ökologische Herausforderungen dar. Ob es gelingt, den Kokainhandel weiterhin einzudämmen, ist eine Frage. Hier wird derzeit heiß über eine mögliche Rückkehr der Drug Enforcement Administration (DEA) diskutiert, die aus Gründen der nationalen Souveränität von Morales zusammen mit der US-Botschaft des Landes verwiesen worden war. Schließlich stehen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Verfasstheit an: Im zweiten Kabinett Morales gab es einmal Geschlechterparität. Darüber hinaus ist so wenig passiert wie beim Umweltschutz – den "Rechten der Pachamama“. Feminizide sind an der Tagesordnung. Die öffentliche Sicherheit ist generell ein wachsendes Problem, das Gefängniswesen katastrophal. Fälle indigener Autonomien lassen sich, anderthalb Jahrzehnte nachdem sie vielbeachtetes Novum in der neuen Verfassung waren, an den Fingern einer Hand abzählen. Immerhin: Im Gegensatz zu politischen Gegnern wie Quiroga steht Rodrigo Paz zu Bolivien als plurinationalem Staat, wie er in der Verfassung von 2009 verankert ist, und nicht für eine Rückkehr zur Republik, die stets excluyente und diskriminierend war. Schon in der Woche nach der Amtseinführung wurde ein Dialog mit der Justiz gestartet. Deren erbärmlicher Zustand war mit unterschiedlichen Urteilen zum passiven Wahlrecht von Morales, je nach Maßgabe der jeweiligen Machtverhältnisse, unübersehbar geworden und erreichte bereits in der Woche nach den Wahlen mit der Einstellung von Verfahren sowie der Freilassung von Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom November 2019 seinen Höhepunkt. Zuletzt wurde auch die „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez freigelassen, die den Sicherheitskräften per Dekret Straffreiheit zugesichert hatte. Im nunmehr eingestellten Verfahren ging es unter anderem um die Massaker von Sacaba (15.11.) und Senkata (19.11.) mit zusammen mehr als 20 Todesopfern. Just während dieser Beitrag online ging, hat Präsident Paz den frischernannten Justizminister Freddy Vidovic entlassen, der eine Vorstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes verschwiegen hatte. Vidovic war Anwalt Laras gewesen und der einzige von dessen Gefolgsleuten im Kabinett. Nur Stunden später löste Paz gleich das ganze Justizministerium auf. Ob das der richtige Weg ist? Von der Straffreiheit zur „Unterhaltsamkeit“? Die Absolution für die formal verantwortliche Frau Añez, die von MASistas als „fotogene Barbiepuppe der Putschisten von 2019“ und „Bauernopfer“ angesehen wird, mag nach fünf Jahren gerecht erscheinen. Gingen doch aktive Täter leer aus und wichtige Drahtzieher haben bei den zurückliegenden Wahlen sogar kandidiert, während sie im Frauengefängnis von Miraflores saß. Unterdessen wurde der glücklose Amtsvorgänger Luis Arce, der inzwischen wieder Wirtschaftsvorlesungen an der UMSA ( Universidad Mayor de San Andrés ) gibt, von den Verwaltern des Parteikürzels MAS (die mit 3,1 Prozent der Stimmen gerade noch Parteistatus behalten durfte) aus der Partei ausgeschlossen. Ein weiteres Bauernopfer? Soll so womöglich der Weg für eine Rückkehr von Morales bereitet werden? Letzterer sitzt weiterhin unter dem Schutz seiner Getreuen in einer tropischen Palisadenfestung in seiner Hochburg, dem Kokaanbaugebiet des Chapare. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen ist. Ihm wird vorgeworfen, mit einer seinerzeit 15-jährigen ein Kind gezeugt zu haben. Weil ihm wiederholt minderjährige Frauen ins argentinische Exil zugeführt worden sein sollen, lautet ein weiterer Vorwurf auf Menschenhandel. Mit seinem Aufruf, aus Protest gegen die Nichtzulassung zur Kandidatur ungültig zu wählen, landete der Hauptverantwortliche für den Zerfall der MAS im ersten Wahlgang indirekt immerhin bei rund 15 Prozent, mehr als die anderen Konkurrenten auf der Linken zusammen. Während die sich weiterhin in einer Art Schockstarre zu befinden scheinen, mischt Morales mit seinem kommunalen Radio bereits wieder in der politischen Auseinandersetzung mit. Von einem „Delinquenten mit Territorium, Radiostation und Straflosigkeit“, den man stoppen müsse, sprach der Präsidentenvater Jaime Paz Zamora. Morales sprach ihm seinerseits „die Moral“ zu urteilen ab, weil er in betrunkenem Zustand einen Passanten totgefahren und seinerzeit „Ströme von Blut“ durchschwommen habe, als er 1989 mit dem Exdiktator Banzer koalierte, um den Wahlsieger „Goni“ Sánchez de Lozada auszubremsen und selbst Präsident zu werden. (Vor den Wahlen hatte Jaime Paz damals erklärt: „Von Banzer trennen uns Ströme von Blut“. „Goni“ wurde später zweimal Präsident und noch später im Exil von einem US-Gericht wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt.) Es verbietet sich natürlich, vom Vater auf den Sohn zu schließen. Der erklärte, man habe nicht ein Land im Stillstand übernommen, sondern eine „Kloake der Korruption“ und spricht von „veruntreuten 15 Milliarden Dollar oder mehr“. Was aus den einstmals so starken sozialen Bewegungen wird, ob sie sich erholen? Auch sie sind tief gespalten. Gerade wurde der kürzlich als Chef des mächtigen Gewerkschaftsbundes COB zurückgetretene Juan Carlos Huarachi wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Damit scheinen zumindest einige Wegweiser erkennbar, wie es politisch in Bolivien weitergehen könnte, das bis 2005 fast zwei Jahrhunderte lang als instabilstes Land Lateinamerikas gegolten hatte. Rechtsradikale und Kettensägenpolitiker scheinen dem Land vorerst erspart geblieben zu sein. Doch es könnte „unterhaltsam“ werden – zumindest für unbeteiligte Beobachter.

Während die eigentliche certification für drogenpolitisches Wohlverhalten erst im kommenden Frühjahr verkündet wird, ist der Grundlagenbericht dazu bereits fertig und hat insbesondere in Kolumbien Staub aufgewirbelt. Zusammen mit Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela wird dem traditionell engsten Verbündeten der USA in Südamerika bescheinigt, dass er im zurückliegenden Jahr seinen drogenpolitischen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei ( demonstrably failed wie es heißt). Präsident Gustavo Petro protestierte, hat Waffenkäufe eingefroren und beschuldigt Washington, sich in den Wahlkampf einzumischen. Die mit einer decertification verbundenen Sanktionen wurden aber aus Gründen der nationalen Sicherheit ausgesetzt. Kurios ist das Verdikt im Fall Afghanistan, das ohnehin Sanktionen unterliegt. Dort steigt zwar die Produktion von Cannabis und Amphetaminen. Der Anbau von Schlafmohn wurde im weltweit wichtigsten Ursprungsland für Heroin von den Taliban aber um 95 Prozent reduziert. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen 20 Jahren westlicher Sicherheitskooperation unter Führung Washingtons, wo Schlafmohnanbau und Heroinproduktion alljährlich neue Rekordhöhen erreicht hatten. Nebenbei: Für die USA ist Afghanistan drogenpolitisch eher uninteressant. Ihre illegalen Märkte werden aus Lateinamerika beliefert, insbesondere aus Mexiko und Kolumbien. Auf internationaler Ebene wird das alljährliche Zertifizierungsritual Washingtons schon lange nicht mehr ernst genommen. Pure Symbolpolitik also? Nicht ganz, denn für die Regierung der Vereinigten Staaten ist es ein sehr preiswertes Druckmittel. So nahm die Opposition in Kolumbien den Steilpass aus Washington vor den im Mai 2026 stattfindenden Wahlen dankbar an. Die Linksregierung Gustavo Petro würde den Ruf des Landes ruinieren und ausländische Investitionen gefährden, so etwa die Journalistin und konservative Präkandidatin Vicky Dávila. Das Weiße Haus unterstreicht darüber hinaus, dass sich die Entscheidung ausdrücklich auf die politische Führung des Landes beziehe und lobt die Fähigkeiten und den Mut der kolumbianischen Sicherheitskräfte. US-Außenminister Rubio legte noch nach und nannte Präsident Petro einen „Agenten des Chaos“, seine Politik „irrlichternd“. Zuletzt wurde ihm sogar das Einreisevisum in die USA entzogen. Das renommierte Washington Office on Latin America (WOLA) hingegen kommentierte: Die jahrzehntealte Praxis, andere Staaten durch die certification für ihre angeblich mangelhafte Drogenpolitik zu beurteilen und zu bestrafen, sei ein antiquiertes, grobschlächtiges und kontraproduktives außenpolitisches Instrument und sollte abgeschafft werden. Näheres zu den drogenpolitischen Fakten in Kolumbien und den Ursprüngen der certification im vorangegangenen Beitrag „Drogen: Kolumbien im Visier“. Kanonenbootpolitik Der Militäraufmarsch der USA vor der venezolanischen Küste hat inzwischen Gestalt angenommen und zu ersten Opfern geführt. Am 2. September berichtete Präsident Trump auf seinen sozialen Kanälen, im Rahmen einer von ihm selbst ausdrücklich angeordneten Operation sei ein Boot der venezolanischen „ Tren de Aragua narcoterrorists“ versenkt worden. Ein unscharfes Video zeigte, wie ein mit mehreren Personen besetztes Boot in Flammen aufgeht. Stand heute (27.9.) sollen es vier Schnellboote sein. Die Zahl der getöteten Menschen soll inzwischen bei 17 liegen. Nur im letzten Fall wurden anschließend tatsächlich Drogen aus dem Wasser gefischt. Dominikanische Sicherheitskräfte wollen 1.000 Kilogramm Kokain sichergestellt haben. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei jedenfalls um außergerichtliche Tötungen. Gleich der erste, am besten dokumentierte, Fall, wirft Fragen auf. Weder wurden Drogen präsentiert, noch irgendwelche Beweise vorgelegt, dass das Boot für die Organisation „ Tren de Aragua “ unterwegs war. Nach Recherchen der investigativ-journalistischen Plattformen „The Intercept“ und „InSight Crime“ war das Boot im venezolanischen Bundesstaat Sucre gestartet und hatte außergewöhnlich viele Personen an Bord. Die Rede ist von 11. Die fragliche Route werde für Schmuggelgut aller Art und auch von Migranten genutzt. Ein Versuch, das Boot zu stoppen und zu beschlagnahmen sowie die Besatzung zu verhaften, wurde nicht unternommen, obwohl es nach Darstellung des Außenministers Marco Rubio möglich gewesen wäre. Vielmehr habe es nach einem ersten Angriff umgedreht, sei dann aber durch eine Drohne weiter beschossen worden und in Flammen aufgegangen. WOLA spricht von einer Gruppenexekution auf hoher See. „Polizeiliche Fahndung bringt nichts“, sagte Marco Rubio dazu auf einer Pressekonferenz in Mexiko: „Was sie stoppen wird ist, wenn du sie in die Luft jagst.“ Das Vorgehen ist freilich nicht neu und erinnert an die Operation Airbridge Denial . Ab Mitte der 1990er Jahre waren nicht identifizierte Kleinflugzeuge, die im Verdacht standen, das Zwischenprodukt Pasta Básica de Cocaína aus den Anbaugebieten in Bolivien und Peru zur Weiterverarbeitung nach Kolumbien zu transportieren, zur Landung gezwungen oder notfalls abgeschossen worden. Im April 2001 führte anscheinend ein Kommunikationsfehler zwischen dem US-Aufklärer und dem peruanischen Jäger zum Abschuss einer Cesna mit einer US-Missionarsfamilie an Bord. Zwei Menschen starben und der Congress in Washington stellte Fragen. Das Programm wurde eingestellt. Der Unterschied ist die Unilateralität: Heute sind US-amerikanische Soldaten auch am Abzug. Zu Recht wird die Begründung kritisiert, es handle sich um eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der gewinnorientierte Drogenhandel, ein kleines Schnellboot gar, soll eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen? Dieser juristische Winkelzug – also die Definition von organisierten Verbrechern des Drogenhandels zur Terrororganisation – dient dazu, dass man nach US-Recht das Militär gegen sie einsetzen darf. Auch dies ist nicht neu. Die Administrationen der Präsidenten Bush und Obama rechtfertigten mit dem „Krieg gegen den Terror“ außergerichtliche Tötungen von Al Qaeda- und Taliban-Führern. Und Präsident Ronald Reagan argumentierte bereits zu Beginn des Jahres 1986 in einer National Security Decision Directive , Drogen seien zu einer Bedrohung der Nationalen Sicherheit geworden. Das diente damals schon dazu, mit den Anti-Drogen-Gesetzespaketen von 1986 und 1988 das Militär in die Drogenkontrolle einzubeziehen. Zunächst an den US-Außengrenzen ( border interdiction ), dann auch in den sogenannten Produzentenländern ( going to the source ). Hohe Militärs wandten damals dagegen ein, sie seien dafür nicht ausgebildet. Search and destroy sei ihre Aufgabe, nicht Verhaftung und Beweisaufnahme. Wenn man sich das Ausmaß der seitdem angewachsenen Drogenimporte und des Drogenkonsums vor Augen führt, so kann man nur sagen: Die Militarisierung der Drogenkontrolle war ein absoluter Holzweg mit sehr hohen Nebenkosten: Teuer, wirkungslos und mit Verletzungen von Menschenrechten sowie der nationalen Souveränität der betroffenen Länder verbunden. Mehrere Kriegsschiffe, ein atomgetriebenes U-Boot und insgesamt 4.000 Soldaten sollen am aktuellen Aufmarsch beteiligt sein. Zehn Kampfjets wurden nach Puerto Rico verlegt, einer nach Guyana, das sich im Grenzstreit mit Venezuela befindet. Der venezolanische Präsident Maduro persönlich wird beschuldigt, in den Drogenhandel verstrickt zu sein, ohne dass dafür Beweise vorgelegt wurden. Auf ihn wurde ein Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen US Dollar ausgesetzt. Venezuela mobilisierte seine Reservisten, und Maduro 2.500 Soldaten und 12 Kriegsschiffe zu einer Militärübung Operation Souveräne Karibik 200 , erklärte aber gleichzeitig seine Gesprächsbereitschaft. Der frühere Chef des US Southern Command, General James Stavridis, fand klare Worte: „ Gunboat diplomacy is back, and it can work .“ Die Regierungen Mexikos, Kolumbiens und Brasiliens warnten vor der Gefahr einer militärischen Konfrontation. Der sagenhafte fliegende Holländer ist dazu verdammt, ewig die Meere zu durchsegeln ohne jemals einen Hafen (ein Ziel) zu erreichen. Die europäischen Verbündeten haben in der Vergangenheit stets alle drogenpolitischen Absurditäten Washingtons und andere außenpolitische Abenteuer (stillschweigend) mitgetragen. Kann der politische Wiedergänger und derzeitige Kapitän des Geisterschiffs auch heute darauf bauen?
Blog
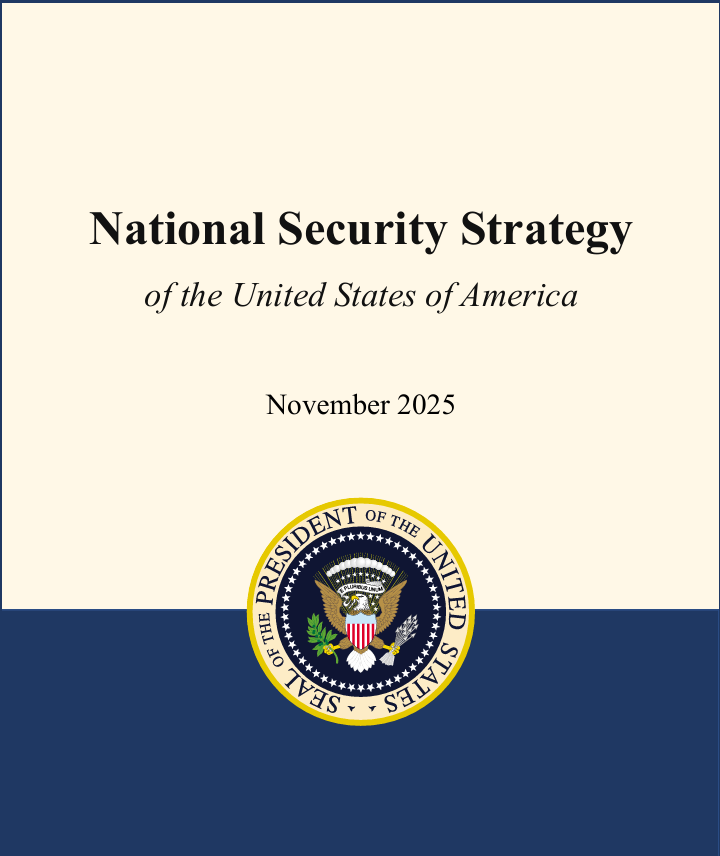
Aus europäischer Sicht mag man darüber spekulieren, ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trumpschen National Security Strategy am 4.12. mit der dreistelligen Millionenstrafe gegen Elon Musks Plattform X (verkündet am 5.12.) durch die Europäische Union zu tun hat. Eine ähnliche Strafe hat es ja bereits im September gegen Google gegeben. Weitere Verfahren gegen US Tech-Giganten – eine Kapitalfraktion, deren Eigentümer zu den reichsten Männern der Welt und den wichtigsten Unterstützern von The Donald gehören – sind in Brüssel anhängig. Vorwürfe über Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Demokratie werden als Umkehr der Tatsachen wahrgenommen und zurückgewiesen, denn sie finden ja gerade unter der Trump-Regierung statt sowie bei deren besonders engen Freunden in Europa. Eine Überempfindlichkeit angesichts der globalen Reichweite des gesamten Papiers einerseits und seiner begrenzten praktisch-politischen Bedeutung als Richtschnur andererseits? National Security Strategies hat es schon viele gegeben: G.W. Bush 2002 und 2006, Obama 2010 und 2015, Trump I 2017, Biden 2021 und 2022. Eine zunehmende Häufigkeit im 21. Jahrhundert mag mit der Volatilität der Weltlage zusammenhängen. Die vorliegende Strategy ist mit 33 Seiten – inklusive Deckblatt und Vorwort – vergleichsweise sehr kurz und pamphlethaft. Seit dem unverschämten Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar sind die Vorwürfe an Europa ja hinlänglich bekannt. Nun hat man es auch noch schwarz auf weiß. Von wirtschaftlichem Niedergang, dem Verlust von Selbstvertrauen und der "starken Gefahr einer zivilisatorischen Auslöschung“ ist da die Rede. Es sei fraglich, ob Europa ein verlässlicher Verbündeter bleibe. Im Zentrum der Kritik steht in der Tat die Europäische Union mit ihrer Regulierungswut sowie multilaterale Regulierungen überhaupt: „The larger issues facing Europe include activities of the European Union and other transnational bodies that undermine political liberty and sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating strife.“ Schon einleitend heißt es unter ‚Prinzipien‘: „We will oppose elite-driven, anti-democratic restrictions of core liberties in Europe, the Anglosphere, and the rest of the democratic world, especially among our allies.“ Und: „We reject the disastrous ‚climate change‘ and ‚Net Zero‘ ideologies that have so greatly harmed Europe, threaten the United States, and subsidize our adversaries.“ Eine Scheidungsurkunde also, wie manche Kommentatoren meinen? Schlimmer! Ein Adoptionsangebot, verbunden mit einer Kriegserklärung gegen universelle Werte wie Menschenrechte, Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat sowie ihre multilateralen Wächter. Europa: „Promoting European Greatness“ Nach allgemeinen Darlegungen zu Zielen, Prinzipien, Strategien und Werkzeugen folgen in der zweiten Hälfte des Papiers die Weltregionen. Der Abschnitt zu Europa ist mit ‚Förderung seiner Größe‘ überschrieben, was wohl nicht als Ausdehnung des Gebiets zu verstehen ist, sondern im Sinne von Großartigkeit. Europa bleibe „strategically and culturally vital to the United States“ . Europa abzuschreiben wäre selbstzerstörerisch. Und: „…the growing influence of patriotic European parties indeed gives cause of great optimism.“ Elon Musks offensive Parteinahme für die deutsche AfD im Wahlkampf kommt da in Erinnerung. Angestrebt ist demnach eine Partnerschaft mit einem Europa der Orbans und Ficos, der AfD und der FPÖ, der PiS, der VOX und des Rassemblement National. Übrigens: Russland wird nur in zwei Absätzen mit seinem Verhältnis zu Europa erwähnt, ansonsten in der ganzen Strategie nicht. In der Tat steht Putin weltanschaulich und gesellschaftspolitisch Trump ja näher als etwa Macron, Starmer oder Sánchez. Beider Denken geht mitunter hinter die Aufklärung zurück. Russland erscheint als wirtschaftlich irrelevant und als keine strategische Bedrohung wahrgenommen zu werden. Die Vision: Eine Welt souveräner Nationalstaaten unter einem starken Führer Auch ansonsten gibt es große Übereinstimmungen in Weltsicht und Selbstbild, angefangen mit der Selbstüberhöhung. Idealbild ist, ähnlich wie bei den Identitären, eine Welt souveräner und kulturell homogener Nationen, die konkurrieren und kooperieren, frei von supranationalen Regulierungen und nach dem Gesetz des Stärkeren. Eine solche Ordnung der Welt sei gottgegeben, Multilateralismus erscheint implizit quasi als Teufelswerk. Die gesamte Strategie ist vom Gedanken an eine natur- oder gottgegebene Überlegenheit der USA als gods own country oder manifest destiny durchtränkt, die teilweise wiederhergestellt werden müsse. An verschiedenen Stellen beruft sie sich auf Gott. Noch häufiger erscheint der Name Trump. „Over the past nine months, we have brought our nation – and the world – back from the brink of catastrophe and disaster. After four years of weakness, extremism, and deadly failures, my administration has moved with urgency and historic speed to restore American strength at home and abroad, and bring peace and stability to our world. No administration in history has achieved so dramatic a turnaround in so short a time. (…) „America is strong and respected again – and because of that, we are making peace all over the world.“ So messianisch beginnt das Vorwort des Präsidenten. Von Russland war bereits die Rede. Einen weiteren Hinweis auf geopolitische Gewichtungen gibt die Länge der jeweiligen Kapitel, wobei Europa mit zweieinhalb Seiten nach Asien und Lateinamerika erst an dritter Stelle kommt, vor Nahost mit zwei und Afrika mit einer halben Seite. Der Nahe Osten erscheint als eine von der Trump-Administration weithin befriedete Region, wo auf der arabischen Halbinsel exzellente Geschäfte winken. Die Rede ist tatsächlich von Frieden, nicht von einem fragilen Waffenstillstand, der täglich gebrochen wird und Todesopfer fordert. Die jeweiligen Regierungs- und Gesellschaftssysteme und ihre Entwicklung solle man dort sich selbst überlassen – im Gegensatz zu Lateinamerika, aber dazu später. Reformen könne man freilich begrüßen. Das gilt auch für die Menschenrechte und offenbar auch für Herrscher, die kritische Journalisten foltern und ermorden lassen. Als geopolitischer roter Faden zieht sich die Eindämmung Chinas durch das ganze Dokument, nicht zuletzt durch das mit sechs Seiten längste, das Asienkapitel. Hier geht es um Marktanteile, legitimen oder unlauteren Wettbewerb und in geostrategischer Hinsicht um die freie Schifffahrt nicht nur im Südchinesischen Meer und um Taiwan, wobei auch hier die Verbündeten einen größeren Eigenbeitrag leisten müssten. Als solche werden ausdrücklich Europa, Japan, Korea, Australien, Kanada und Mexiko genannt. Indien solle hinzugewonnen werden. Um die Zurückdrängung Chinas geht es auch im zweitlängsten Kapitel, dem zu Lateinamerika: „Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine“ Die Überschrift lässt keinen Zweifel daran, worum es geht. Die Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823 definierte Lateinamerika als exklusive Einflusszone der USA und war – keine fünfzig Jahre nach der eigenen Unabhängigkeitserklärung – gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet. Mit der Roosevelt-Corollary (Zusatz) von 1904 behielt sich Washington eine Schiedsrichterrolle bei inneramerikanischen Konflikten und ein exklusives Interventionsrecht vor, wie es bereits in der ersten Verfassung Kubas von 1902 festgeschrieben worden war, das nach dem Sieg im Spanisch-Amerikanischen Krieg den USA zugefallen war. Die Überschrift des Lateinamerika-Kapitels unterstreicht, dass man an diese Tradition anknüpfen will, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Fortsetzung in der containment policy fand, der Eindämmung des „Kommunismus“ - und nach der Revolution von 1959 vor allem Kubas. Unter Marco Rubio, dem Außenminister mit kubanischen Wurzeln, geht es mit anderen Begrifflichkeiten weiterhin darum, vordergründig jedoch um Sicherheit. Nicht im Sinne einer Invasion fremder Truppen über die südliche Landesgrenze, sondern um Migration und Drogen. Darüber hinaus und vor allen Dingen aber geht es um die Zurückdrängung Chinas, den Zugriff auf Rohstoffe und die Schwächung unliebsamer Regierungen, die diesen erschweren. „After years of neglect, the United States will reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere, and to protect our homeland and our access to key geographies throughout the region. We will deny non-Hemispheric competitors the ability to position forces or other threatening capabilities, or to own or control strategically vital assets, in our Hemisphere. This ‚Trump Corollary‘ to the Monroe Doctrine is a common-sense and potent restoration of American power and priorities, consistent with American security interests.“ Dass auswärtige Wettbewerber, zum wirtschaftlichen und strategischen Nachteil der USA, bedeutenden Zutritt zur Region gewinnen konnten, ohne dass sie ernsthaft zurückgedrängt wurden, sei ein großer strategischer Fehler gewesen. „The terms of our alliances, and the terms upon which we provide any kind of aid must be contingent on winding down adversarial outside influence – from control of military installations, ports, and key infrastructure to the purchase of strategic assets broadly defined.“ Die Botschaften der USA sollen sich der Förderung von Geschäftskontakten widmen. „At the same time, we should make every effort to push out foreign companies that build infrastructure in the region.“ Das bezieht sich wohl insbesondere auf den neuen Megahafen in Chancay bei Lima in Peru, der von der chinesischen COSCO gebaut und unlängst eröffnet wurde. Die USA wollen Partner „erster Wahl“ sein … „and will (through various means) discourage their collaboration with others.“ Die Länder der Hemisphäre hätten die Wahl zwischen einer „American-led world of souvereign countries and free economies or a parallel one in which they are influenced by countries on the other side of the world.“ Unter anderem solle auch die Militärpräsenz überdacht werden, was bedeute: „A readjustment of our global military presence to adress urgent threats in our Hemisphere, especially the missions identified in this strategy, and away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years." (Anm. R.L.: siehe die Verlegung der USS Gerald Ford, des größten US Flugzeugträgers, vom Mittelmeer in die Karibik.) (…) „Targeted deployments to secure the border and defeat cartels, including where necessary the use of lethal force to replace the failed law enforcement -only strategy of the last several decades; and Establishing or expanding access in startegically important locations.“ Bereits im einleitenden Teil des Strategiepapiers wird unter ‚Prinzipien‘ deutlich gemacht, dass zwar die Gründerväter in der Unabhängigkeitserklärung den Vorzug für Interventionsverzicht niedergelegt hätten. Aber: „For a country, whose interests are numerous and diverse as ours, rigid adherence to non-interventionism is not possible.“ Die ersten Monate der Trump-Administration gaben reichlich Beispiele dafür, wie man sich das in der Praxis vorzustellen hat: Vom Druck auf die Regierung Panamas, weil ein chinesisches Unternehmen den Ausgang des Panama-Kanals kontrolliere; über Interventionsdrohungen gegen die Regierung Claudia Sheinbaum in Mexiko, damit diese Grenzkontrollen und Drogenbekämpfung intensivieren und militarisieren solle; zu Bestrebungen, den Luftwaffenstützpunkt Manta in Ecuador wieder zu nutzen (was bei einem Referendum von der Wählerschaft zurückgewiesen wurde); über die flagranten Einmischungen in die brasilianische Justiz im Fall des Putschisten Jair Bolsonaro und in die Wahlen in Honduras; bis zum beispiellosen Militäraufmarsch vor der Küste Venezuelas und der Versenkung angeblicher Drogenschnellboote auf offener See, die rein gar nichts zur Linderung der Drogenprobleme in den USA beitragen wird. Letztere bezeichnet der UNO Hochkommissar für Menschenrechte als völkerrechtswidrig und der UN Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismus, der australische Völkerrechtler Professor Ben Saul, spricht von Mord, weil weder eine militärische, noch eine terroristische Bedrohung und schon gar kein Krieg – also auch kein Kriegsverbrechen – vorliege. „Legalität ist eine Machtfrage“ hat Ulrike Meinhof gesagt. Ist es zulässig, eine Terroristin zu zitieren? Vielleicht, wenn es um Terrorismus geht, um die Frage, ob es sich – wie von der Trump-Administration behauptet – um „Narcoterrorismus“ handelt oder um „Staatsterrorismus“. Es muss nicht wirklich verwundern, wenn bei schwierigeren Bedingungen für die Kapitalakkumulation, schärferer Weltmarktkonkurrenz, knappen Rohstoffen und multiplen Krisen Vernunft und gute Sitten über Bord geworfen werden, wenn bellizistische Rhetorik üblich wird, wenn Völker- und Menschenrecht dem Feuilleton überlassen bleiben. Bemerkenswert ist, dass es sich im vorliegenden Papier vielfach um die pseudo-konzeptionelle Untermauerung der realen politischen Praxis handelt, statt um eine Strategie für die Zukunft. Mehr als alles andere wird die Großartigkeit der Vereinigten Staaten und ihres aktuellen Präsidenten beschworen. Anders als im vorliegenden Dokument stehen sich im realen Leben nicht einfach Nationalstaaten gegenüber. Noch gibt es auch in den Vereinigten Staaten eine Opposition, zivilgesellschaftliche Organisationen, unterschiedliche veröffentlichte Meinungen. Der diesseits des Atlantiks üblich gewordene Kotau gegenüber Trump und seiner Regierung ist nicht einfach nur peinlich. Er lässt ihn zuhause erfolgreich dastehen und stärkt ihm den Rücken gegenüber seinen Kritikern. Ob die Lateinamerikaner – Progressisten oder Konservative – von der ihnen zugedachten Rolle als Arena des Ringens zweier Großmächte oder schlicht als Untergebene begeistert sein werden? Bisher gibt es kaum Reaktionen. Interessant ist ferner, was nicht in der Strategie steht: Von einer Einverleibung Kanadas ist so wenig die Rede wie vom Kauf Grönlands. Übrigens: Es gibt auch durchaus richtige Wahrnehmungen und bedenkenswerte Einschätzungen in dem Dokument, das einmal mehr Einblick in die Denkweise seiner Väter gibt. Die darin zum Ausdruck gebrachte Weltsicht ist gefährlich anachronistisch. https://www.whitehouse.gov/up-content/uploads/2025/2025-National-Security-Strategy.pdf
Der Wahlsieg war mit 54:45 Prozent in der Stichwahl ebenso überzeugend wie insgesamt überraschend. Rodrigo Paz Pereira ist auf der großen politischen Bühne seines Landes ein Newcomer. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 17. August hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Seine politische Karriere begann er im Jahr 2002 als Abgeordneter des Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Bewegung der Revolutionären Linken - MIR), das sein Vater, Jaime Paz Zamora (später 60. Präsident von 1989 bis 1993), im Jahr 1971 während der Zeit der Militärdiktaturen im chilenischen Exil mitbegründete. Zwischen 2015 und 2020 war Paz Pereira Bürgermeister seiner Heimatstadt Tarija und ab 2020 Senator von Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadana . Nun gewann er auf dem Ticket der bisher bedeutungslosen Christdemokratischen Partei (PDC) zunächst mit 32,06 Prozent der Stimmen vor dem zweiten Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre ) mit 26,7 Prozent. Die Linke, die mit dem Movimiento al Socialismo (MAS) in den letzten zwei Jahrzehnten seit 2005 stets absolute Mehrheiten erzielt hatte, ist zersplittert und in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. (Wir berichteten in diesem Blog: "Bolivien: Totalschaden für die Linke" und frühere Beiträge.) Das heißt auch: Im Parlament wird sich die neue Regierung Mehrheiten suchen müssen. Der ursprünglich favorisierte Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad ), der unter Vater Jaime Paz einmal Minister war, landete auf dem dritten Platz und hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt. Ebenso wie der in Umfragen vor der Stichwahl ebenfalls favorisierte klare Verlierer „Tuto“ Quiroga (54:45 Prozent). Alle drei „Parteien“ sind rechts der Mitte zu verorten. Zusammen kämen sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Vergangenheit hatte bei Bedarf die US-Botschaft solche Allianzen geschmiedet. „Kapitalismus für alle…“ …lautet Paz‘ Versprechen. Bolivien ist ein Land ohne Kapitalisten (sprich: unternehmerische Tradition). Bis 1952 beherrschten drei Zinnbarone die wirtschaftlichen und politischen Geschicke. Nach der Revolution von 1952/53 folgte eine Periode des Staatskapitalismus, die politisch unter anderem deshalb scheiterte, weil sich mit Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce und Juan Lechín mehrere Caudillos um die Kontrolle des regierenden Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) stritten. Eine Parallele zur Aktualität: Um die MAS und ihr Erbe stritten sich vor ihrem Niedergang Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez und Eduardo del Castillo. Seinerzeit folgten von 1964 bis 1982 lange Jahre teilweise blutiger Militärdiktaturen. Der Staatskapitalismus dauerte an. Ihm folgte ab 1982 eine gewählte Linksregierung, die 1986 an einer Hyperinflation zerbrach. Der Führer der Revolution von 1952, Víctor Paz Estenssoro, gewann die Wahlen und leitete eine neoliberale Strukturanpassung nach Vorgaben des IWF ein, die bei hohen sozialen Kosten makroökonomische Stabilisierung brachte. Für die maroden Staatsbetriebe wollte sich aber fast ein Jahrzehnt lang kein Käufer finden, bis sie in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Sonderkonditionen überwiegend an ausländische Investoren verhökert wurden. Bolivien wurde zum Aid Regime, ausländische „Entwicklungshilfe“ zum Akkumulationsersatz. Das interne Steueraufkommen reichte oft nicht einmal aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Ein Jahrzehnt später war das Modell gescheitert und die MAS übernahm im Januar 2006 nach einem Erdrutschsieg das Ruder. Das Wirtschaftsmodell soll heute also weniger staatszentriert sein und mehr auf Marktwirtschaft und Privatinvestitionen setzen. Vor allem aber wird es auf Auslandsfinanzierung angewiesen sein. In der Ministerriege fallen erfahrene Technokraten auf. Einige haben für die Vereinten Nationen gearbeitet, andere waren vor 2006 schon einmal Minister. Die Umstellung dürfte weniger rabiat erfolgen als unter der selbsternannten Interimsregierung, die nach der Machtergreifung der Rechten im November 2019 ein Jahr lang nach Kräften versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder auch unter Quiroga, der bereits unter dem Exdiktator Hugo Banzer (1997-2001) einmal als Vizepräsident und nach dessen Krebstod ein Jahr lang bis 2002 auch als Präsident einen strikt neoliberalen Kurs fuhr. Leicht wird es nicht werden. Die Kassen sind leer und das Land leidet seit Monaten unter Treibstoff- sowie Devisenknappheit. Gleich am Tag nach der Amtseinführung konnte der neue Präsident einen Lkw-Konvoi mit hunderten von Zisternen voll Treibstoff begrüßen. Erinnerungen an Chile 1973 drängen sich auf. Eine erste Auslandsreise hatte den designierten Präsidenten schon vorher nach Washington geführt, von wo er Kreditzusagen (die Rede ist von sechs Milliarden US-Dollar) mitbrachte sowie eine Vereinbarung, umgehend wieder diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Zur Erinnerung: Präsident Morales hatte diese nach dem Zivilputsch vom September 2008 abgebrochen; zur Jahrtausendwende entsprachen ausländische „Entwicklungshilfen“ jeweils etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Amtseinführung waren Vertreter Nicaraguas, Venezuelas, Kubas und des Iran ausdrücklich nicht eingeladen. Ein deutliches Zeichen für den Kurswechsel in der Außenpolitik. Ohne Basis, Programm und Struktur Die PDC ist eine Partei ohne Programm und ohne Basis. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt aber ein Spiegelbild der bisherigen Polarisierung. Paz gewann die Stichwahl in sechs von neun Departements (in La Paz, Cochabamba, Potosí und Oruro mit mehr als 60 Prozent). Quiroga gewann in den Tieflanddepartements Santa Cruz und Beni; nahezu gleichauf lagen beide in Tarija. Darin zeigt sich noch einmal die Tragik des politischen Versagens der MAS. Deren frühere Wählerinnen und Wähler im Hochland entschieden sich nun doch eher für die moderate Rechte, zumal der Vizepräsidentschaftskandidat von Libre , Juan Pablo Velasco, wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen war. Damit ist nicht gesagt, dass die neue Regierung auch auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Wählerklientel eingehen wird. Bei der konnte nicht zuletzt der nunmehrige Vizepräsident Edmand Lara punkten, ein Polizist, der aus dem Dienst entlassen worden war, nachdem er Polizeikorruption angeprangert hatte. Der erklärte Bewunderer des salvadorianschen Präsidenten Nayib Bukele erwarb sich so einen Ruf als unbestechlicher Korruptionsbekämpfer und besticht selbst durch fleißiges Posten populistischer Äußerungen auf TikTok. Seinen Amtseid legte er in Polizeiuniform ab. Es gibt Beobachter die meinen, mit ihm als Spitzenkandidat hätte die PDC im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen können. Dementsprechend fällt Lara durch großes Selbstbewusstsein und Ambitionen auf, beklagt mangelnde Kommunikation von Paz mit ihm und betont bei jeder Gelegenheit, er würde in der Regierung nicht fünftes Rad am Wagen sein. Möglich, dass Lara sich als stärkste Oppositionskraft in der eigenen Regierung herausstellt. Übrigens: Laras Frau wurde – wie Quirogas Schwester – schon im ersten Wahlgang auf einem sicheren Listenplatz Abgeordnete. Kapitalismus für alle, das Versprechen dürfte sich neben ausländischen Investoren vielleicht noch für eine neue Mestizo-Bourgeoisie erfüllen, die gestärkt aus dem proceso de cambio der MAS-Jahre hervorgegangen ist. Sie sorgt sich um ihr kürzlich erworbenes Vermögen, scheut staatliche Kontrolle und Interventionismus, möchte aber auch nicht gänzlich auf Regulierung verzichten. Die Umverteilungspolitik der MAS beruhte auf dem Export von Erdgas und Erdöl, auf Extraktivismus, und war von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten abhängig. Die Erschließung neuer Quellen hatte man vernachlässigt, auf Diversifizierung lange verzichtet. Obwohl Bolivien wahrscheinlich auf den weltweit größten Lithiumvorkommen sitzt und man von Anfang an gute Konzepte hatte – nicht nur den Rohstoff wollte man exportieren, sondern zumindest Batterien – ist auch dabei nichts Zählbares weitergegangen. Nachdem sich die Europäer 2019 selbst aus der Poleposition geschossen hatten, auch nicht mit zuletzt chinesischen und russischen Partnern. Die Herausforderungen sind groß. Der informelle Sektor ist weiter angewachsen. 85 Prozent der Menschen sollen ganz oder teilweise auf ihn angewiesen sein. Das Budgetdefizit lag 2024 bei 10,62 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jährlich wiederkehrende Großfeuer und die Vergiftung von Flüssen durch Goldsucher stellen große ökologische Herausforderungen dar. Ob es gelingt, den Kokainhandel weiterhin einzudämmen, ist eine Frage. Hier wird derzeit heiß über eine mögliche Rückkehr der Drug Enforcement Administration (DEA) diskutiert, die aus Gründen der nationalen Souveränität von Morales zusammen mit der US-Botschaft des Landes verwiesen worden war. Schließlich stehen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Verfasstheit an: Im zweiten Kabinett Morales gab es einmal Geschlechterparität. Darüber hinaus ist so wenig passiert wie beim Umweltschutz – den "Rechten der Pachamama“. Feminizide sind an der Tagesordnung. Die öffentliche Sicherheit ist generell ein wachsendes Problem, das Gefängniswesen katastrophal. Fälle indigener Autonomien lassen sich, anderthalb Jahrzehnte nachdem sie vielbeachtetes Novum in der neuen Verfassung waren, an den Fingern einer Hand abzählen. Immerhin: Im Gegensatz zu politischen Gegnern wie Quiroga steht Rodrigo Paz zu Bolivien als plurinationalem Staat, wie er in der Verfassung von 2009 verankert ist, und nicht für eine Rückkehr zur Republik, die stets excluyente und diskriminierend war. Schon in der Woche nach der Amtseinführung wurde ein Dialog mit der Justiz gestartet. Deren erbärmlicher Zustand war mit unterschiedlichen Urteilen zum passiven Wahlrecht von Morales, je nach Maßgabe der jeweiligen Machtverhältnisse, unübersehbar geworden und erreichte bereits in der Woche nach den Wahlen mit der Einstellung von Verfahren sowie der Freilassung von Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom November 2019 seinen Höhepunkt. Zuletzt wurde auch die „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez freigelassen, die den Sicherheitskräften per Dekret Straffreiheit zugesichert hatte. Im nunmehr eingestellten Verfahren ging es unter anderem um die Massaker von Sacaba (15.11.) und Senkata (19.11.) mit zusammen mehr als 20 Todesopfern. Just während dieser Beitrag online ging, hat Präsident Paz den frischernannten Justizminister Freddy Vidovic entlassen, der eine Vorstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes verschwiegen hatte. Vidovic war Anwalt Laras gewesen und der einzige von dessen Gefolgsleuten im Kabinett. Nur Stunden später löste Paz gleich das ganze Justizministerium auf. Ob das der richtige Weg ist? Von der Straffreiheit zur „Unterhaltsamkeit“? Die Absolution für die formal verantwortliche Frau Añez, die von MASistas als „fotogene Barbiepuppe der Putschisten von 2019“ und „Bauernopfer“ angesehen wird, mag nach fünf Jahren gerecht erscheinen. Gingen doch aktive Täter leer aus und wichtige Drahtzieher haben bei den zurückliegenden Wahlen sogar kandidiert, während sie im Frauengefängnis von Miraflores saß. Unterdessen wurde der glücklose Amtsvorgänger Luis Arce, der inzwischen wieder Wirtschaftsvorlesungen an der UMSA ( Universidad Mayor de San Andrés ) gibt, von den Verwaltern des Parteikürzels MAS (die mit 3,1 Prozent der Stimmen gerade noch Parteistatus behalten durfte) aus der Partei ausgeschlossen. Ein weiteres Bauernopfer? Soll so womöglich der Weg für eine Rückkehr von Morales bereitet werden? Letzterer sitzt weiterhin unter dem Schutz seiner Getreuen in einer tropischen Palisadenfestung in seiner Hochburg, dem Kokaanbaugebiet des Chapare. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen ist. Ihm wird vorgeworfen, mit einer seinerzeit 15-jährigen ein Kind gezeugt zu haben. Weil ihm wiederholt minderjährige Frauen ins argentinische Exil zugeführt worden sein sollen, lautet ein weiterer Vorwurf auf Menschenhandel. Mit seinem Aufruf, aus Protest gegen die Nichtzulassung zur Kandidatur ungültig zu wählen, landete der Hauptverantwortliche für den Zerfall der MAS im ersten Wahlgang indirekt immerhin bei rund 15 Prozent, mehr als die anderen Konkurrenten auf der Linken zusammen. Während die sich weiterhin in einer Art Schockstarre zu befinden scheinen, mischt Morales mit seinem kommunalen Radio bereits wieder in der politischen Auseinandersetzung mit. Von einem „Delinquenten mit Territorium, Radiostation und Straflosigkeit“, den man stoppen müsse, sprach der Präsidentenvater Jaime Paz Zamora. Morales sprach ihm seinerseits „die Moral“ zu urteilen ab, weil er in betrunkenem Zustand einen Passanten totgefahren und seinerzeit „Ströme von Blut“ durchschwommen habe, als er 1989 mit dem Exdiktator Banzer koalierte, um den Wahlsieger „Goni“ Sánchez de Lozada auszubremsen und selbst Präsident zu werden. (Vor den Wahlen hatte Jaime Paz damals erklärt: „Von Banzer trennen uns Ströme von Blut“. „Goni“ wurde später zweimal Präsident und noch später im Exil von einem US-Gericht wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt.) Es verbietet sich natürlich, vom Vater auf den Sohn zu schließen. Der erklärte, man habe nicht ein Land im Stillstand übernommen, sondern eine „Kloake der Korruption“ und spricht von „veruntreuten 15 Milliarden Dollar oder mehr“. Was aus den einstmals so starken sozialen Bewegungen wird, ob sie sich erholen? Auch sie sind tief gespalten. Gerade wurde der kürzlich als Chef des mächtigen Gewerkschaftsbundes COB zurückgetretene Juan Carlos Huarachi wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Damit scheinen zumindest einige Wegweiser erkennbar, wie es politisch in Bolivien weitergehen könnte, das bis 2005 fast zwei Jahrhunderte lang als instabilstes Land Lateinamerikas gegolten hatte. Rechtsradikale und Kettensägenpolitiker scheinen dem Land vorerst erspart geblieben zu sein. Doch es könnte „unterhaltsam“ werden – zumindest für unbeteiligte Beobachter.

Während die eigentliche certification für drogenpolitisches Wohlverhalten erst im kommenden Frühjahr verkündet wird, ist der Grundlagenbericht dazu bereits fertig und hat insbesondere in Kolumbien Staub aufgewirbelt. Zusammen mit Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela wird dem traditionell engsten Verbündeten der USA in Südamerika bescheinigt, dass er im zurückliegenden Jahr seinen drogenpolitischen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei ( demonstrably failed wie es heißt). Präsident Gustavo Petro protestierte, hat Waffenkäufe eingefroren und beschuldigt Washington, sich in den Wahlkampf einzumischen. Die mit einer decertification verbundenen Sanktionen wurden aber aus Gründen der nationalen Sicherheit ausgesetzt. Kurios ist das Verdikt im Fall Afghanistan, das ohnehin Sanktionen unterliegt. Dort steigt zwar die Produktion von Cannabis und Amphetaminen. Der Anbau von Schlafmohn wurde im weltweit wichtigsten Ursprungsland für Heroin von den Taliban aber um 95 Prozent reduziert. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen 20 Jahren westlicher Sicherheitskooperation unter Führung Washingtons, wo Schlafmohnanbau und Heroinproduktion alljährlich neue Rekordhöhen erreicht hatten. Nebenbei: Für die USA ist Afghanistan drogenpolitisch eher uninteressant. Ihre illegalen Märkte werden aus Lateinamerika beliefert, insbesondere aus Mexiko und Kolumbien. Auf internationaler Ebene wird das alljährliche Zertifizierungsritual Washingtons schon lange nicht mehr ernst genommen. Pure Symbolpolitik also? Nicht ganz, denn für die Regierung der Vereinigten Staaten ist es ein sehr preiswertes Druckmittel. So nahm die Opposition in Kolumbien den Steilpass aus Washington vor den im Mai 2026 stattfindenden Wahlen dankbar an. Die Linksregierung Gustavo Petro würde den Ruf des Landes ruinieren und ausländische Investitionen gefährden, so etwa die Journalistin und konservative Präkandidatin Vicky Dávila. Das Weiße Haus unterstreicht darüber hinaus, dass sich die Entscheidung ausdrücklich auf die politische Führung des Landes beziehe und lobt die Fähigkeiten und den Mut der kolumbianischen Sicherheitskräfte. US-Außenminister Rubio legte noch nach und nannte Präsident Petro einen „Agenten des Chaos“, seine Politik „irrlichternd“. Zuletzt wurde ihm sogar das Einreisevisum in die USA entzogen. Das renommierte Washington Office on Latin America (WOLA) hingegen kommentierte: Die jahrzehntealte Praxis, andere Staaten durch die certification für ihre angeblich mangelhafte Drogenpolitik zu beurteilen und zu bestrafen, sei ein antiquiertes, grobschlächtiges und kontraproduktives außenpolitisches Instrument und sollte abgeschafft werden. Näheres zu den drogenpolitischen Fakten in Kolumbien und den Ursprüngen der certification im vorangegangenen Beitrag „Drogen: Kolumbien im Visier“. Kanonenbootpolitik Der Militäraufmarsch der USA vor der venezolanischen Küste hat inzwischen Gestalt angenommen und zu ersten Opfern geführt. Am 2. September berichtete Präsident Trump auf seinen sozialen Kanälen, im Rahmen einer von ihm selbst ausdrücklich angeordneten Operation sei ein Boot der venezolanischen „ Tren de Aragua narcoterrorists“ versenkt worden. Ein unscharfes Video zeigte, wie ein mit mehreren Personen besetztes Boot in Flammen aufgeht. Stand heute (27.9.) sollen es vier Schnellboote sein. Die Zahl der getöteten Menschen soll inzwischen bei 17 liegen. Nur im letzten Fall wurden anschließend tatsächlich Drogen aus dem Wasser gefischt. Dominikanische Sicherheitskräfte wollen 1.000 Kilogramm Kokain sichergestellt haben. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei jedenfalls um außergerichtliche Tötungen. Gleich der erste, am besten dokumentierte, Fall, wirft Fragen auf. Weder wurden Drogen präsentiert, noch irgendwelche Beweise vorgelegt, dass das Boot für die Organisation „ Tren de Aragua “ unterwegs war. Nach Recherchen der investigativ-journalistischen Plattformen „The Intercept“ und „InSight Crime“ war das Boot im venezolanischen Bundesstaat Sucre gestartet und hatte außergewöhnlich viele Personen an Bord. Die Rede ist von 11. Die fragliche Route werde für Schmuggelgut aller Art und auch von Migranten genutzt. Ein Versuch, das Boot zu stoppen und zu beschlagnahmen sowie die Besatzung zu verhaften, wurde nicht unternommen, obwohl es nach Darstellung des Außenministers Marco Rubio möglich gewesen wäre. Vielmehr habe es nach einem ersten Angriff umgedreht, sei dann aber durch eine Drohne weiter beschossen worden und in Flammen aufgegangen. WOLA spricht von einer Gruppenexekution auf hoher See. „Polizeiliche Fahndung bringt nichts“, sagte Marco Rubio dazu auf einer Pressekonferenz in Mexiko: „Was sie stoppen wird ist, wenn du sie in die Luft jagst.“ Das Vorgehen ist freilich nicht neu und erinnert an die Operation Airbridge Denial . Ab Mitte der 1990er Jahre waren nicht identifizierte Kleinflugzeuge, die im Verdacht standen, das Zwischenprodukt Pasta Básica de Cocaína aus den Anbaugebieten in Bolivien und Peru zur Weiterverarbeitung nach Kolumbien zu transportieren, zur Landung gezwungen oder notfalls abgeschossen worden. Im April 2001 führte anscheinend ein Kommunikationsfehler zwischen dem US-Aufklärer und dem peruanischen Jäger zum Abschuss einer Cesna mit einer US-Missionarsfamilie an Bord. Zwei Menschen starben und der Congress in Washington stellte Fragen. Das Programm wurde eingestellt. Der Unterschied ist die Unilateralität: Heute sind US-amerikanische Soldaten auch am Abzug. Zu Recht wird die Begründung kritisiert, es handle sich um eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der gewinnorientierte Drogenhandel, ein kleines Schnellboot gar, soll eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen? Dieser juristische Winkelzug – also die Definition von organisierten Verbrechern des Drogenhandels zur Terrororganisation – dient dazu, dass man nach US-Recht das Militär gegen sie einsetzen darf. Auch dies ist nicht neu. Die Administrationen der Präsidenten Bush und Obama rechtfertigten mit dem „Krieg gegen den Terror“ außergerichtliche Tötungen von Al Qaeda- und Taliban-Führern. Und Präsident Ronald Reagan argumentierte bereits zu Beginn des Jahres 1986 in einer National Security Decision Directive , Drogen seien zu einer Bedrohung der Nationalen Sicherheit geworden. Das diente damals schon dazu, mit den Anti-Drogen-Gesetzespaketen von 1986 und 1988 das Militär in die Drogenkontrolle einzubeziehen. Zunächst an den US-Außengrenzen ( border interdiction ), dann auch in den sogenannten Produzentenländern ( going to the source ). Hohe Militärs wandten damals dagegen ein, sie seien dafür nicht ausgebildet. Search and destroy sei ihre Aufgabe, nicht Verhaftung und Beweisaufnahme. Wenn man sich das Ausmaß der seitdem angewachsenen Drogenimporte und des Drogenkonsums vor Augen führt, so kann man nur sagen: Die Militarisierung der Drogenkontrolle war ein absoluter Holzweg mit sehr hohen Nebenkosten: Teuer, wirkungslos und mit Verletzungen von Menschenrechten sowie der nationalen Souveränität der betroffenen Länder verbunden. Mehrere Kriegsschiffe, ein atomgetriebenes U-Boot und insgesamt 4.000 Soldaten sollen am aktuellen Aufmarsch beteiligt sein. Zehn Kampfjets wurden nach Puerto Rico verlegt, einer nach Guyana, das sich im Grenzstreit mit Venezuela befindet. Der venezolanische Präsident Maduro persönlich wird beschuldigt, in den Drogenhandel verstrickt zu sein, ohne dass dafür Beweise vorgelegt wurden. Auf ihn wurde ein Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen US Dollar ausgesetzt. Venezuela mobilisierte seine Reservisten, und Maduro 2.500 Soldaten und 12 Kriegsschiffe zu einer Militärübung Operation Souveräne Karibik 200 , erklärte aber gleichzeitig seine Gesprächsbereitschaft. Der frühere Chef des US Southern Command, General James Stavridis, fand klare Worte: „ Gunboat diplomacy is back, and it can work .“ Die Regierungen Mexikos, Kolumbiens und Brasiliens warnten vor der Gefahr einer militärischen Konfrontation. Der sagenhafte fliegende Holländer ist dazu verdammt, ewig die Meere zu durchsegeln ohne jemals einen Hafen (ein Ziel) zu erreichen. Die europäischen Verbündeten haben in der Vergangenheit stets alle drogenpolitischen Absurditäten Washingtons und andere außenpolitische Abenteuer (stillschweigend) mitgetragen. Kann der politische Wiedergänger und derzeitige Kapitän des Geisterschiffs auch heute darauf bauen?
Noch vor der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses ist die Lage klar: In die Stichwahl am 19. Oktober kommen Rodrigo Paz Pereira von den Christdemokraten (PDC mit vorläufig 32,09 Prozent der Stimmen) und der Rechtskonservative Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre mit 26,93). Dahinter liegt auf Platz 3 der liberale Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad Nacional mit 19, 92). Es folgten der vormalige MAS-Senatspräsident Andrónico Rodríguez ( Alianza Popular 8,11), der Bürgermeister von Cochabamba Manfred Reyes Villa ( Sumate 6.63) und der vormalige Innenminister Eduardo del Castillo (MAS, im Bild), der mit 3,14 Prozent gerade noch die Dreiprozenthürde nehmen konnte. Bei der Stichwahl zwischen Paz und Quiroga geht es im präsidentialistischen Bolivien um das besonders wichtige Präsidentenamt. Sieht man sich die voraussichtliche Sitzverteilung im Zweikammernparlament an, fällt der Abgesang der Linken noch krasser aus: Hatte die MAS dort zuletzt nach den Wahlen von 2020 noch knapp eine Zweidrittelmehrheit verfehlt, bleiben nach heutigem Stand der Dinge noch fünf Sitze für die Alianza Popular und einer für die MAS. Doch auch für die Wahlsieger könnte es fraglich werden, ob sich eine Mehrheit ausgeht. Eine Rechtsallianz war vor den Wahlen gescheitert. Quiroga scherte aus, weil der in Umfragen besser platzierte Doria Medina Spitzenkandidat werden sollte. Letzterer hat bereits angekündigt, in der Stichwahl Paz zu unterstützen. Doch ob eine Allianz von Christdemokraten und Unidad hält und sichere Mehrheiten bringt? Solche wird man sich suchen müssen. Ob Stabilität das bisherige Chaos ablöst ist fraglich. Banzerismo durch die Hintertür? Alle drei stehen freilich für eine Rückkehr zum Neoliberalismus. Beziehungen zu Washington dürften schnell wieder angeknüpft werden. Dass es zu Umkehrungen des Prozesses des Wandels ( proceso de cambio ) kommt ist wahrscheinlich. Schon ist von Freilassung der „politischen Gefangenen“ die Rede. Der Zementunternehmer Samuel Doria Medina war bereits zu Beginn der 1990er Jahre Minister im Kabinett des Präsidenten Jaime Paz Zamora, dessen ursprünglich sozialdemokratisches Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) einen hohen Preis im Kampf gegen die Militärdiktaturen gezahlt hatte, dann aber doch mit dem Exdiktator Hugo Banzer koalierte und letztlich in Korruptionsskandalen versank. Er gilt als gemäßigt liberal. „Tuto“ Quiroga war ein knappes Jahrzehnt später nach Banzers Krebstod ein Jahr lang zum Präsident aufgerückt. Teil der damaligen Megakoalition waren auch die Christdemokraten. Hugo Banzer, Absolvent der US Army School of the Americas, hatte sich im August 1971 an die Macht geputscht und war bis Juli 1978 einer der blutigsten Militärdiktatoren. Im Juli 1997 wurde er demokratisch zum Präsidenten gewählt. Überraschungswahlsieger Rodrigo Paz Pereira wird als Newcomer gesehen. Seine Wahl ist Ausdruck des Überdrusses mit den politischen Dinosauriern sowie Misswirtschaft und Korruption, für die man die MAS verantwortlich macht. Die Umfragen vor den Wahlen hatten ihn gar nicht auf dem Radar. Zu Fernsehdebatten war er nicht eingeladen. Ohne nennenswerte Parteiinfrastruktur war er vielmehr persönlich durch das Land getourt. „Wir sind die Stimme derer, die bisher keine Stimme hatten“, sagte er bei einer spontanen Siegesfeier mit einer Handvoll seiner Anhänger auf der Hahnentreppe ( grados del gallo ), die in La Paz den Prado mit der Calle Mexico verbindet. Wie sein Vater Jaime Paz Zamora (Präsident von 1989 bis 1993), dessen Spitzname „ el gallo “ war, hat er einen Hahn als Symbol. Seine eigene Karriere hat er im Jahr 2002 als Abgeordneter in dessen MIR begonnen. Später war er Bürgermeister der Stadt Tarija (2015-2020) und zuletzt ab 2020 Senator für Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadano (CC). Wie gesagt: Seine Christdemokarten waren seinerzeit auch Teil von Hugo Banzers Megakoalition. Paz Pereira, der im September 58 Jahre alt wird, ist also durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Als Zugpferd und Sympathieträger gilt sein Vizepräsidentschaftskandidat Edman Lara, der sich bei der Polizei von Cochabamba als mutiger Korruptionsbekämpfer einen Namen gemacht hat und dort auch eine Degradierung dafür in Kauf nahm. Inwieweit Paz für einen Neuanfang stehen kann, bleibt abzuwarten. Doria Medina hat ihm bereits Unterstützung bei der Stichwahl zugesagt, und auch für Linke dürfte er eher wählbar sein als der Rechtsaußen Quiroga. Nullsummenspieler Sofern diese nicht auf den Altpräsidenten Evo Morales setzen, der nicht mehr kandidieren durfte und sich in seiner Bastion, dem Kokaanbaugebiet Chapare , von Anhängern protegiert verschanzt hat, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. (Wir berichteten.) In Bolivien herrscht Wahlpflicht. Morales hatte dazu aufgerufen, aus Protest ungültig zu wählen ( voto nulo ) und in der Tat liegen die ungültigen Stimmen mit 19,1 Prozent auf Platz 4. Er verfügt also durchaus noch über eine Anhängerschaft und ist täglich in den Medien präsent. Allerdings: Seine Aufrufe zu Märschen und Blockaden hatten zuletzt immer mehr an Zugkraft und Gefolgschaft verloren. Von den genannten 19,1 Prozent der Stimmen darf man getrost mindestens 5 Prozent üblicher Nullvoten abziehen; bei den äußerst politisierten Wahlen von 2020, die die MAS bei einer Rekordwahlbeteiligung von 88 Prozent mit 55,1 Prozent der Stimmen zur Abwahl der de facto-Regierung gewonnen hatte, waren es immerhin auch 3,5 Prozent Nullvoten. Bei einer Wahlbeteiligung von diesmal eher nur 77 Prozent und einer außergewöhnlich großen Unübersichtlichkeit angesichts eines beinahe unmerklichen Wahlkampfs sowie von last minute–Allianzen dürften es deutlich mehr sein, die damit nicht Morales’ Protestaufruf gefolgt sind. Bei Vorwahlumfragen waren die Unentschlossenen die größte Gruppe. Rechnet man die Stimmen der MAS mit jenen von Andrónico Rodríguez zusammen und schlägt hypothetische Morales - Proteststimmen von 10 Prozent dazu, so hätte eine MAS – Krise und Querelen hin oder her – durchaus noch eine Rolle spielen können. Doch der Morales-Schüler Andrónico Rodríguez wollte durchaus nicht mit den Anhängern des glücklosen Präsidenten Luis Arce (MAS) paktieren, der ihm sogar den Spitzenplatz freigeräumt hatte. Bis zur Stunde habe man das Wahlziel erreicht, die MAS-IPSP ( Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos ) vor der Auslöschung zu retten, erklärte der Spitzenkandidat Eduardo del Castillo. Mit nur 3,14 Prozent der Stimmen und nur einem Sitz in der Abgeordnetenkammer ein wahrlich bescheidener „Erfolg“ angesichts der Ergebnisse der letzten mehr als 20 Jahre. Selbst als die MAS im Jahr 2002 zum ersten Mal antrat wurde sie auf Anhieb zweitstärkste Kraft und gewann 8 von seinerzeit 27 Senatoren und 27 von 130 Abgeordneten. Del Castillo selbst wertet es als Resultat rücksichtsloser Egoismen – man könnte es auch einen kompletten Mangel an politischer Weitsicht und Verantwortungsgefühl bezeichnen. Immerhin schaut del Castillo nach vorne und lädt „desorientierte“ Abweichler dazu ein, in die Reihen der MAS zurückzukehren. Paz und Quiroga würden eine neoliberale Schocktherapie anwenden und die Krise für die einfachen Leute noch verschlimmern. Nach 20 Jahren habe die MAS sich verjüngt und die Kader mit Blick auf die nächsten 30 Jahre ausgetauscht. Im Unterschied zu den anderen Parteien, die seit 25 Jahren auf die gleichen Personen setzen. Zumindest Letzteres stimmt weithin. Hoffnungen auf einen Neuanfang im Jahr 201 nach der Unabhängigkeit von der Spanischen Krone bleiben bescheiden. Nachtrag 24.8. Amtliches Endresultat Stimmen PDC 32,06 Libre 26,70 Unidad 19,69 AP 8,51 MAS 3,17 Nulo 19,7 Sitze Diputados PDC 56 Libre 43 Unidad 22 AP 6 MAS 1 insg. 130 Senado PDC 16 Libre 12 Unidad 7 insg. 36 Auflistung unvollständig; eine Allianz zwischen PDC und Unidad hätte demnach in beiden Kammern eine Mehrheit.
„Wir werden nicht zulassen, dass wir wieder die Bösen sind“, sagte Laura Gil, die scheidende kolumbianische Botschafterin in Wien, die als Stellvertretende Generalsekretärin zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) geht. Kolumbien habe enorme Opfer im Kampf gegen den Drogenhandel gebracht. In der Tat berichtet der im Juni vom Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime ) mit Sitz in Wien veröffentlichte World Drug Report 2025 von einer Kokainschwemme, die vor allem auf eine abermalige Rekordproduktion in Kolumbien zurückgeht. Kokain sei der am schnellsten wachsende illegale Drogenmarkt, konstatiert das UNODC. Die Kokainproduktion liege mit geschätzten 3.708 Tonnen (Zahlen für 2023) um 34 Prozent höher als 2022. Was den Anbau des pflanzlichen Grundstoffs betrifft, die Blätter des Kokabusches, so entfallen auf Kolumbien 253.000 Hektar, auf Peru 92.784 und auf Bolivien 31.000. Und während er in Bolivien stabil und in Peru leicht zurückgegangen sei, nehme er in Kolumbien rapide zu – und nicht nur das. Verbesserte Sorten und Anbaumethoden sowie Innovationen bei der Weiterverarbeitung der Kokablätter bringen auch höhere Erträge. Während die Kokaanbaufläche dort um 10 Prozent angewachsen sei, rechnet man mit einem Anstieg der Kokainproduktion um 50 Prozent. Und so fürchtet man in Bogotá die alljährliche „certification“ durch den US-Präsidenten – auch wenn sie offiziell nicht mehr so heißt, denn dieser heißt nun Donald Trump. Imperiale Zertifizierung Gemäß dem bereits 1986 in der Amtszeit von Ronald Reagan verabschiedeten Anti-Drug-Abuse-Act muss der Präsident alljährlich überprüfen, ob sogenannte drogenproduzierende - oder Transitländer ihren drogenpolitischen Verpflichtungen nachgekommen sind und „kooperativ“ waren. Wenn nicht, werden automatisch eine Reihe von Sanktionen fällig, wie der Stopp von US-Hilfen, Handelssanktionen und US-Vertreter werden auch bei internationalen Organisationen wie der Weltbank gegen Kreditbewilligungen stimmen. Diese Sanktionen können wiederum ausgesetzt werden, wenn der Präsident erklärt, dass nationale Sicherheitsinteressen dies geraten erscheinen lassen. Für die betroffenen Länder ein beträchtliches Damoklesschwert, mit dem es Washington gelang, dort jeweils seine Sicht der Dinge und mitunter sehr konkrete Maßnahmen durchzusetzen. Nur Weltpolizist Uncle Sam verfügt (seit 1978) über ein Büro für internationale Drogenangelegenheiten und Gesetzesvollzug im Außenministerium, das unter anderem für eine permanente Überwachung sorgt. Im März dieses Jahres waren es Bolivien, Burma und Venezuela die, wie es heißt: „have demonstrably failed their obligations“. Doch noch unterzeichnete Präsident Biden das unter seiner Regierung entstandene Dokument, der ihnen bescheinigte, dass eine fortgesetzte Unterstützung „vital to the national interests of the United States“ sei.(1) Die „certification“ ist also keine Erfindung der Trump-Administration, passt aber als (un)diplomatische Anmaßung perfekt in deren imperiales Amerika-First-Weltbild. Schon die Auswahl der betroffenen Länder macht deutlich, dass es hier eben nicht primär um die Lösung drogenpolitischer Probleme geht: Bolivien ist mit weitem Rückstand nur der drittgrößte Kokaproduzent. Venezuela spielt eine Rolle beim Transit, aber vornehmlich nach Europa, nicht in die USA. Die Regierungen beider Länder sind Washington freilich ein Dorn im Auge. Desgleichen Brasilien, wo aktuell Richter und Staatsanwälte von den USA mit Sanktionen überzogen werden, die in Sachen der aktiven Beteiligung des Expräsidenten Jair Bolsonaro am Putschversuch gegen Wahlsieger Lula da Silva vom 8. Januar 2023 tätig sind. Und brasilianische Waren sind nun in USA mit 50-prozentigen Zöllen belegt. Da überrascht es nicht, wenn Außenminister Marco Rubio dem kolumbianischen Expräsidenten Álvaro Uribe (2002-2010) unverzüglich mit einer Richterschelte beispringt. Uribe, dem Verbindungen zu rechtsextremen Paramilitärs vorgeworfen werden, wurde soeben wegen Zeugenbeeinflussung verurteilt. Und die Verhängung von 50-prozentigen Zöllen auf Kupfer trifft vor allem die Linksregierung von Gabriel Boric in Chile, dem wichtigsten Kupferexporteur, die sich bei den im November bevorstehenden Wahlen einer wieder erstarkten extremen Rechten gegenüber sieht. Es geht hier um politischen Kulturkampf, nicht um die Lösung von Problemen. Tatsächliche Drogenprobleme Diese stellen gesundheitspolitische Herausforderungen und Probleme im Bereich der Organisierten Kriminalität dar. So beklagt der World Drug Report 2025 einen weiteren Anstieg der Drogenkonsumenten auf 316 Millionen (6 Prozent der Weltbevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren); davon 244 Cannabis-, 61 Opioid-, 30,7 Amphetamin-, 25 Kokain-, und 21 Millionen Ecstasykonsumenten. Die Gesamtzahl ist höher als 316 Millionen, weil häufig mehrere Substanzen konsumiert werden, was besonders riskant ist, wenn es gleichzeitig geschieht. Hier zeichnet sich aber eine positive Entwicklung ab. Der Cannabis-Konsum junger Menschen geht deutlich zurück. Das gelte unabhängig davon, ob strikte Prohibition herrsche oder liberalere Gesetze und sei auf gestiegenes Gesundheitsbewusstsein beziehungsweise Risikowahrnehmung zurückzuführen, hört man aus dem UNODC. Die Drogenberichte Deutschlands und Österreichs bestätigen dies und berichten Gleiches auch über den Alkoholkonsum, auch wenn konservative Politiker angesichts der neuen Cannabis-Gesetzgebung des vormaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach Zeter und Mordio schrien, noch bevor irgendwelche (belastbaren) Zahlen vorlagen und sogar den Kölner Bandenkrieg vom letzten Sommer damit in Verbindung brachten, wo es doch gerade darum geht, diesen Banden durch einen regulierten, legalen Markt den Boden zu entziehen. Die größten Gesundheitsprobleme liegen nach wie vor sehr eindeutig bei Opiaten und ihrer Verabreichung durch Spritzen sowie Opioiden. Laut UNODC sind Hepatitis C- und HIV-Infektionen für zwei Drittel der tödlich endenden Drogenkarrieren verantwortlich. Und in Nordamerika sterben alljährlich Zehntausende im Rahmen der „Fentanyl-Krise“ an Opioid-Überdosen. Gerade hier zeichnet sich auch für Europa ein Problem ab, das paradoxerweise mit dem bislang erfolgreichen Anbauverbot für Schlafmohn durch die Taliban in Afghanistan verbunden ist. Die Opiumproduktion, Ausgangsprodukt für Heroin, ist dort um 95 Prozent gesunken; weltweit sind es nur 72 Prozent, weil Myanmar (Burma) nun wieder mehr produziert. Bisher haben üppige Lagerbestände dafür gesorgt, dass die Angebotsverknappung auf den europäischen Märkten kaum zu spüren war. Sie dürften noch bis 2026 halten. Doch schon sind einerseits die Opiumpreise in Afghanistan um das Zehnfache gestiegen und es besteht andererseits die Gefahr, dass eine Verknappung dazu führt, dass das Endprodukt Heroin durch wesentlich potentere und gefährlichere Fentanyle oder Nitazene gestreckt oder ersetzt wird. Ein unkalkulierbares Risiko. Eine neue Ära globaler Instabilität habe die Herausforderungen im Kampf gegen das Drogenproblem intensiviert, Gruppen der Organisierten Kriminalität (OK) gestärkt und den Drogenkonsum auf Rekordniveau gehoben, schreibt die scheidende UNODC-Chefin Ghada Waly in ihrem Vorwort. Drogen sind weltweit die wichtigste Einkommensquelle für Gruppen der OK. Hier macht sich der World Drug Report 2025 Gedanken über ein gezieltes Vorgehen gegen solche Gruppen und deren Schlüsselpositionen und -figuren. Da geht es um dreistellige Milliardenbeträge, wenngleich Schätzungen schwierig sind. So gehe fast die Hälfte der Geldwäscheoperationen in Europa auf Drogengeschäfte zurück. Konventionelle Standardmaßnahmen hätten sich als wenig effizient erwiesen. Eine übergroße Anzahl von Verfahren betreffe Drogenbesitz und -konsum. Neue Töne aus Wien. Experten beklagen seit langem, dass überwiegend kleine Fische verfolgt werden. Gerade für lateinamerikanische Länder stellt die OK mit ihren Einnahmen aus dem expandierenden Kokaingeschäft ein besonderes Problem dar. Verschiedene ihrer Gruppen fordern dort nicht nur Rechtstaatlichkeit und Demokratie heraus, sie haben vielfach auch territoriale Kontrolle erlangt: etwa in brasilianischen Favelas oder ganzen Landstrichen Mexikos und Kolumbiens. So stellt das im Jahr 1993 in einem Gefängnis in São Paulo gegründete Primeiro Comando da Capital (PCC) in Brasilien, dem inzwischen zweitgrößten Konsumenten von Kokain nach den USA, laut US State Department die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Es sei dort in 22 der 27 Bundesstaaten aktiv sowie in 16 Ländern weltweit, darunter in den USA und im Nachbarland Bolivien. Im Mai 2024 hat man im Bundesstaat Amazonas 200 Meilen westlich von Manaus 2,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Kolumbien im Visier Warum also Kolumbien? Unter dem Etikett des Kampfes gegen den Drogenhandel und über den Hebel der „certification“ haben die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit auch strategische Interessen verfolgt, die die Trump-Administration gefährdet sieht. Zudem duldet sie keine Unbotmäßigkeiten. Mexiko, wo es neben Drogen vor allem um illegale Migration geht, wurde außerhalb des regulären Verfahrens bereits per Dekret die „certification“ entzogen. Gleich zu seinem Amtsantritt definierte Präsident Trump mexikanische Drogenorganisationen als Terrororganisationen und brachte Präsidentin Claudia Sheinbaum mit Interventionsdrohungen dazu, die Grenzkontrollen zu militarisieren. Mexiko ist für die USA der mit Abstand wichtigste Zulieferer von Opioiden wie Fentanyl und Transitland für Kokain. Kolumbien ist traditionell der wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten in Lateinamerika. Im Rahmen des noch unter Präsident Clinton initiierten Plan Colombia hat Washington dort seit der Jahrtausendwende 12,6 Milliarden USD in die Drogen- und Aufstandsbekämpfung gesteckt. Zwei Drittel davon waren Polizei- und Militärhilfe. Sieben Militärbasen entstanden, wo unter anderem kolumbianische Militärs von US Special Forces für den Drogenkampf ausgebildet wurden, die heute im Rahmen der Regional Security Cooperation ihrerseits Ausbildungsprogramme für Sicherheitskräfte anderer lateinamerikanischer Länder durchführen; im vergangenen Jahr sollen es 6.000 gewesen sein. Zumeist richteten die Regierungen in Bogotá ihre Politik nach den Wünschen Washingtons aus. Wo sie zu eigenwillig waren, half man nach. So führten Korruptionsvorwürfe und der Entzug der „certification“ dazu, dass Präsident Ernesto Samper Mitte der 1990er Jahre in ein Programm zur Besprühung von Kokafeldern mit Glyphosat aus der Luft einwilligte. Die Anbaufläche wuchs in den darauffolgenden Jahren trotzdem um das Dreifache. Waren es ursprünglich nur sechs, so wurde zur Jahrtausendwende in 23 der 33 Departments Koka angebaut. Seither will man mehr als 2,5 Millionen Hektar vernichtet haben – mehr als das Zehnfache der heutigen Rekordanbaufläche. Das Gegenteil einer nachhaltigen Strategie. Insbesondere in den Jahren der Seguridad Democrática unter Präsident Álvaro Uríbe wurde schwerpunktmäßig über Guerillagebiet im Süden des Landes gesprüht. Landesweite Kokareduzierungen um 80.000 Hektar zwischen 2000 und 2004 wurden fast ausschließlich in den südlichen Departments Caquetá und Putumayo erzielt, Hochburgen der Guerilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Diese Strategie, die Guerilla von ihrer wichtigsten Einkommensquelle abzuschneiden, hält man in Washington für ausschlaggebend dafür, dass die FARC schließlich zu Friedensgesprächen bereit waren. Zumindest ebenso wichtig dürfte aber der Einsatz von US-Militärtechnologie ( high value targeting ) gewesen sein, die es erlaubte, Guerillacamps unter dem Blätterdach aufzuspüren. Auf diese Weise konnten etliche ihrer Comandantes gezielt getötet oder gefangen genommen werden. Wie dem auch sei: Im Jahr 2015 wurden die Besprühungen im Rahmen des Friedensprozesses eingestellt, für den Präsident Juan Manuel Santos 2016 den Friedensnobelpreis erhielt. Der Bürgerkrieg mit der ältesten und größten Guerillaorganisation war zu Ende. Tausende ihrer Kämpfer wurden entwaffnet, Hunderte später ermordet. Denn Nachfolger Iván Duque – wie auch etwa die Hälfte der Wahlbevölkerung – hielt nichts vom Friedensabkommen. Insbesondere das Kapitel 4 des Abkommens, wonach die Bauern ihre Kokafelder freiwillig aufgeben und mit Überbrückungskompensationen auf Alternativen umsteigen sollten, hat nicht funktioniert. Nicht nur, weil es eine sehr schwierige Aufgabe gewesen wäre, sondern vor allem, weil es unter der Regierung Duque nicht umgesetzt wurde. Insgesamt ist es nicht gelungen, in den von der Guerilla geräumten Gebieten (rechts-)staatliche Präsenz herzustellen. „You’re going to have to spray“, richtete Donald Trump Iván Duque schon bei dessen Besuch in Washington im Jahr 2020 aus. Der hätte das auch gerne getan, nur wollte die Biden-Administration (ab 2021) diesen Irrsinn nicht mehr finanzieren. Denn nicht nur hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Pflanzengift Glyphosat in Verdacht, krebserregend zu sein. Die Politik der Zwangseradikation hatte sich längst überdeutlich als Nachhaltigkeitsdesaster mit hohen Nebenkosten wie Umweltschäden und Bauernvertreibung erwiesen. Die amtierende Regierung von Gustavo Petro setzte unter dem Motto Paz Total die Befriedungspolitik fort und dabei wieder auf Freiwilligkeit bei den Bauern und legte einen Schwerpunkt auf die Drogenhändler. Da wurden in den beiden vergangenen Jahren sowohl bei den Kokainbeschlagnahmungen (960 Tonnen im Jahr 2024) als auch bei der Entdeckung und Zerstörung von Drogenlabors Rekordergebnisse erzielt. Doch Kokaanbaufläche und Kokainproduktion wachsen weiter. Das Problem liegt heute nicht nur darin, dass Bauern einmal mehr von ihrer Regierung enttäuscht wurden und das Vertrauen verloren. Mit der Auflösung der FARC ist die Situation der territorialen Kontrolle noch komplizierter geworden. Die heutigen Hochproduktivitätszonen – paradoxerweise liegen sie gerade in den früheren Schwerpunktregionen der Guerillabekämpfung im Süden des Landes – befinden sich unter Kontrolle von Guerilla-Dissidenten, rechtsextremen Paramilitärs oder sonstiger bewaffneter Banden. Die Bauern werden dort manchmal sogar zum Anbau gezwungen. So sah sich die Regierung Gustavo Petro im vergangenen Jahr gezwungen 1.400 Polizei- und Militärkräfte in die Regionen El Plateado und Cañón de Micay im Department Cauca zu entsenden, wo es im März dieses Jahres zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit FARC-Dissidenten der Frente Carlos Patiño kam. Im Rahmen ihrer Nationalen Drogenpolitik von 2023 möchte sie bis 2026 40 Prozent der Kokaanbaufläche reduzieren und 50.000 Bauern in alternative Produktion bringen. Doch wurde bereits das bescheidene Eradikationsziel von 10.000 Hektar (2024: 9.403) knapp verfehlt. Retourkutsche? Mit der weiteren Schwerpunktverlagerung der Kokainproduktion in den Süden Kolumbiens wurde das Nachbarland Ecuador mit seinen Pazifikhäfen zum wichtigen Transitland und zum Schauplatz blutiger Revierkämpfe von Drogengangs. Die Rate von Mord und Totschlag kletterte dort von 7,8 (pro 100.000 Einwohnern) im Jahr 2020 auf 45,7 (2023). In Deutschland liegt sie bei 0,82, in Österreich bei 0,87. Ein Fanal war die Besetzung eines Fernsehstudios vor laufenden Kameras durch Angehörige der Bande Los Choneros und die Flucht von deren Chef José Adolfo Macías alias „Fito“ aus dem Gefängnis im Januar 2024, was zur Verhängung des Ausnahmezustands führte. Die Politik der harten Hand des im Frühjahr wiedergewählten ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa kann als Beispiel dafür gelten, was Washington gefällt. Nach seiner erneuten Verhaftung am 25. Juni 2025 wurde „Fito“ umgehend an die USA ausgeliefert. Im Gegensatz zu seiner Kollegin Claudia Sheinbaum in Mexiko, die einen Einsatz ausländischer Truppen auf ihrem Staatsgebiet ablehnt, bemüht sich Noboa darum, dass Washington ecuadorianische Gruppen ebenfalls als Terrororganisationen einstuft, was den Weg dafür frei machen würde. Bereits im Februar 2024 hat die ecuadorianische Regierung gemeinsame Operationen von US-Militärpersonal und ecuadorianischen Sicherheitskräften erlaubt. Bei seinem Besuch in den USA warb Noboa um US-Militärunterstützung und er verhandelte sogar mit dem privaten Söldnerunternehmen Blackwater , das ecuadorianische Sicherheitskräfte für den Straßenkampf ausbilden soll. Der Sender CNN berichtete darüber hinaus über sehr konkrete Pläne, die Luftwaffenbasis Manta wieder zu aktivieren und zum Marinestützpunkt auszubauen. Manta war zwischen 1999 und 2009 eine sogenannte Forward Operation Location – FOL des US Southern Command zur Luftraumüberwachung im Andenraum, bevor ausländische Militärbasen in der neuen Verfassung von 2008 verboten und der Stützpunkt unter Präsident Rafael Correa geschlossen wurde. Die Funktionen von Manta wurden damals teilweise von den erwähnten sieben Militärbasen in Kolumbien übernommen. Ganz anders stellt sich das Verhältnis der Trump-Administration zur kolumbianischen Regierung unter Gustavo Petro dar. Nicht nur steht man deren Politik des Paz Total skeptisch gegenüber (um das Wenigste zu sagen). Gleich zu Beginn von Donald Trumps Amtszeit gab es einen showdown in den Beziehungen, als Präsident Petro Flugzeuge mit abgeschobenen Flüchtlingen zurückwies und dann unter Sanktionsdrohungen zum Einlenken gezwungen wurde. Eine einmalige Brüskierung des wichtigsten Verbündeten. Schon im vergangenen Jahrzehnt war Kolumbien durch Unbotmäßigkeit aufgefallen, als es zusammen mit Mexiko und Guatemala eine Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen (UNGASS 2016) zur Drogenpolitik mit dem Ziel einer Reform erwirkte, was letztlich dann nur teilweise erfolgreich war. In diesem Frühjahr wurde bei der 68. UN Commission on Narcotic Drugs in Wien unter Federführung der eingangs zitierten kolumbianischen Botschafterin Laura Gil eine Resolution eingebracht, die eine Überprüfung des internationalen Regelwerks der Drogenkontrolle durch eine Expertengruppe verlangt. Die Resolution wurde mit 30 Stimmen, 18 Enthaltungen und drei Gegenstimmen angenommen, wozu ein verstörend arrogantes Eingangsstatement der US-Delegation beigetragen haben dürfte. Mit ihr stimmten nur Argentinien und Russland dagegen. Eine historische Abstimmungsniederlage für Washington in diesem Forum. Gerade vor diesem Hintergrund ist – abseits drogenpolitischer Probleme, Erfolge oder Misserfolge – eine „decertification“ als Retourkutsche denkbar. (1) U.S. Department of State/ Bureau for International Narcotics Matters and Law Enforcement Affairs: "International Narcotics Control Strategy Report", Vol. 1 Drugs and Chemical Control, Washington D.C., March 2025. Die zu Grunde liegende Bewertung erfolgt jeweils bereits im Herbst des Vorjahres. PS am 23.8.2025 Rückkehr zur „Militarisierung des Drogenkriegs“? Die sogenannte Militarisierung des Drogenkriegs oder Andenstrategie wurde im Gefolge der Anti-Drug-Abuse-Gesetzespakete von 1986 und 1988 ab 1989 unter George Bush (sen.) ausgearbeitet und am 25. Januar 1990 dem Kongress vorgelegt. Sie sah im Kern die Einbeziehung der jeweiligen Militärs in die Drogenbekämpfung vor. Die Bereitschaft der betroffenen Länder dazu wurde über die „certification“ hergestellt. Nach dreieinhalb Jahrzehnten kann man sagen, dass sie bei hohen Nebenkosten drogenpolitisch erfolglos war. Donald Trump geht nun einen Schritt weiter: Am 8. August meldete die New York Times, Präsident Trump habe eine Direktive an das Pentagon unterzeichnet, um mit Militäreinsätzen gegen jene lateinamerikanischen Drogenorganisationen zu beginnen, die seine Regierung als „terroristisch“ einstuft. Damit werden direkte Einsätze von U.S. Militärs auf fremdem Boden autorisiert. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum reagierte noch am selben Tag: „Die Vereinigten Staaten werden nicht mit ihrem Militär nach Mexiko kommen. (…) Wir kooperieren, wir arbeiten zusammen, aber es wird keine Intervention geben.“ Wenige Tage später berichteten auch europäische Medien, dass Washington die Entsendung mehrerer P-8-Aufklärungsflugzeuge, mindestens eines Kriegsschiffs und eines U-Boots in die südliche Karibik vorbereite. Die Trump-Administration hatte neben dem „Tren de Aragua“ auch das venezolanische „Cartel de los Soles“ – ein dubioses Netzwerk hoher Militärs, die in den Drogenhandel verwickelt sein sollen und über gute Verbindungen zur Regierung verfügen – zur Specially Designitated Global Terrorist (SDGT) erklärt und das Kopfgeld auf Präsident Maduro auf 50 Millionen US-Dollar erhöht. Dieser reagierte mit der Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären in seinem Land. Damit zeichnet sich in einer Region, in der übrigens auch Kuba liegt, eine gefährliche Eskalation ab.

Antonio Guterres muss sparen. Bei einem derzeitigen Haushalt von 3,26 Milliarden (Mrd.) € (3,7 Mrd. USD) will der UNO-Generalsekretär 15-20 Prozent einsparen. Allein im Sekretariat könnten 20 Prozent der Stellen wegfallen. Einzelne Unterorganisationen und Programme verfügen über gesonderte, oft erheblich höhere Budgets, doch auch sie sind von Kürzungen betroffen. Insgesamt könnten 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein. Besondere Gefahr besteht für Einzelorganisationen wie das Flüchtlings- und das Palästinenserhilfswerk (UNHCR und UNRWA), die in Washington besonders ungeliebt sind. Aus der Weltgesundheitsorganisation WHO sind die Vereinigten Staaten gerade wieder ausgetreten; aus der UNESCO (Erziehung, Wissenschaft und Kultur) und dem UNHCHR (Menschenrechte) sind sie unter Trump aus- und unter Biden wieder beigetreten. Dabei sind die Vereinten Nationen wegen notorisch überfälliger Beitragszahlungen ohnehin unter Druck. So waren die USA als wichtigster Geber zum 1.1.2025 mit 1,5 Mrd. USD in Verzug. Der inzwischen zweitwichtigste Geber, China, zahlt auch immer erst zum Jahresende. Angesichts der drängenden Probleme (Kriege, Konflikte, Klima) sind eine regelbasierte Weltordnung und multilaterales Handeln wichtiger denn je. Aber gerade sie sind ein Hindernis für Großmachtambitionen – und Reaktionären in ihrem Kulturkampf seit eh und je ein Dorn im Auge. Der Schweizer Unternehmer Christoph Blocher (Schweizerische Volkspartei) nannte die UNO in Ablehnung eines Beitritts (der dann 2002 doch erfolgte) bereits in den 1980er Jahren einen Hort des Kommunismus. Die USA, China und Russland haben den Internationalen Gerichtshof in Den Haag nie anerkannt und missachten seine Urteile, was nicht verwundert, verfolgen diese drei ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in ihrer Außenpolitik doch expansionistische Ziele. Ganzheitliche Analysen und Nachhaltigkeit Mit den 2015 verabschiedeten nachhaltigen Entwicklungszielen (auch Agenda 2030) legen die Vereinten Nationen schon seit zehn Jahren mehr Wert auf ressortübergreifende Ansätze und Nachhaltigkeit. Soeben (20.5.2025) ist beim in Wien ansässigen Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ein Bericht erschienen: „ Minerals Crime: Illegal Gold Mining “, als Teil einer in Arbeit befindlichen Globalanalyse von Verbrechen, die die Umwelt schädigen. Bereits der World Drug Report 2023 hatte ein ganzes Kapitel 4 der Verschränkung krimineller Aktivitäten und der Umweltzerstörung in Amazonien gewidmet. (Wir berichteten an dieser Stelle: „Amazoniens Unterwelt“, 26. November 2024, robert-lessmann.com/amazoniens-unterwelt/) Gleich fünf UNO-Unterorganisationen erarbeiteten einen Bericht über Ernährungsunsicherheit in Lateinamerika und der Karibik, der bereits 2024 erschienen ist.* Demnach ist die Region nach Asien am meisten von der Klimakrise betroffen. Unmittelbare Folgen sind Extremwetterereignisse und sinkende landwirtschaftliche Produktivität. Soziale Ungleichheit komme als verschärfender Faktor hinzu. Im Jahr 2023 waren 41 Millionen Menschen in der Region von Hunger betroffen; eine besonders starke Zunahme sei in der Karibik festzustellen. 187,6 Millionen Personen leiden unter Ernährungsunsicherheit, eines von zehn Kindern unter fünf Jahren leidet an Mangelernährung. Paradoxerweise gehen Unterernährung und Übergewicht miteinander einher, sagt Karin Hulshof, die Regionaldirektorin von UNICEF für Lateinamerika und die Karibik. Das Recht von Frauen und Kindern auf Nahrung müsse bei allen Entscheidungen zur Klimapolitik Priorität haben, fordert sie. Im Jahr 2022 waren weltweit 5,6 Prozent der Kinder unter fünf Jahren von Übergewicht betroffen. In Lateinamerika waren es 8,6 Prozent. Die Hälfte der Bevölkerung in der Karibik könne sich keine gesunde und ausgewogene Ernährung leisten, in Mittelamerika seien es 26,3 Prozent und in Lateinamerika 26 Prozent. Laut FAO müsse die Landwirtschaft klimaresilienter werden, damit sie zunehmende Herausforderungen durch den Klimawandel und Extremwetterereignisse besser überstehen kann. Ein Bericht des UN-Weltentwicklungsprogramms (UNDP) vom Jänner 2025 analysiert ebenfalls Probleme durch den Klimawandel, geringe Produktivität, schwaches Wirtschaftswachstum, strukturelle Ungleichheit sowie Vertrauensverlust in Politik und Institutionen. Schon bald müsse man in vielen Ländern Lateinamerikas und der Karibik mit Wasserknappheit rechnen und bis zum Jahr 2080 mit einer schweren Wasserkrise. Das UNDP empfiehlt unter anderem Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Technologie. Politische Entscheidungen – zum Beispiel in Argentinien – gehen in eine andere Richtung. Von Seepferdchen und dem Kokain der Meere: Wildlife Crime Report 2024 Auch ein halbes Jahrhundert nach Inkrafttreten des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES, verabschiedet 1973; heute 184 Unterzeichnerstaaten) sind viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet oder vom Aussterben betroffen. Nur wenige Bereiche, wie Elfenbein und Nashorn, genießen globale Aufmerksamkeit. Andere Arten, wie akut vom Aussterben bedrohte Orchideen, werden kaum beachtet. In Südamerika liegen die gravierendsten Probleme im Bereich von Tropenhölzern, wie Großbeschlagnahmungen zeigen. Auch hier weist der Bericht auf gefährliche Verschränkungen verschiedener krimineller Sektoren hin, im konkreten Fall mit dem Drogenhandel und dem illegalen Goldabbau. Auch eine soziale Sensibilität greift Platz, die man sich in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Kokaanbau, auch längst gewünscht hätte. So sind Seepferdchen ein nicht zu unterschätzender illegaler Exportartikel Perus für Aquarien oder getrocknet (nach Asien, etwa Thailand oder die Philippinen). Peru ist übrigens die drittgrößte Fischereination nach China und Indonesien. Die Seepferdchen kommen meist tot oder sterbend als Beifang. Die Illegalität beginnt mit der Anlandung. Fischer sehen den Seepferdchen-Beifang als eine Art Bonus und wissen meist gar nicht, dass ihr Tun illegal ist. Sie wieder in die See zu werfen erscheint so sinnlos wie eine Bestrafung für das unabsichtliche Werk der kleinen Fischer. Illegal ist in Peru aber das Fischen mit Schleppnetzen innerhalb der Fünfmeilenzone, wo die meisten Seepferdchen hängen bleiben dürften. Gute Geschäfte machen Aufkäufer und Händler. Davon zeugen einzelne Beschlagnahmungen im Bereich von mehreren hundert Kilogramm. Im Jahr 2017 wurden 900 kg in Vietnam in einem Container aus Peru beschlagnahmt. Im September 2019 waren es 1.043 kg getrocknete Seepferdchen in einem Schiff vor der peruanischen Küste. Besonders kurios ist die Symbiose von Drogenexport und der illegalen Fischerei durch Mitglieder mexikanischer Drogenorganisationen. Ursprünglich ein willkommenes Zubrot beim Drogentransit, entdeckte man mit der Schwimmblase eines vom Aussterben bedrohten Fisches (Totoaba) das „Kokain der Meere.** Die Fischer erhalten dafür pro Kilo zwischen 500 und 3.000 USD. In China, wo sie in Suppen, in der traditionellen Medizin oder sogar als Wertanlage verwendet wird, kann man 80.000 USD erzielen. Washington isoliert Von einem Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Drogenpolitik spricht Ann Fordham, Direktorin der NGO International Drug Policy Consortium (IDPC): Mit 30 Stimmen, 18 Enthaltungen und drei Gegenstimmen (Argentinien, Russland und die USA) nahmen die Delegierten der 68. Commission on Narcotic Drugs (CND) des Wirtschafts- und Sozialrates der UN, die im März diesen Jahres in der Wiener UNO-City stattfand, eine unter Federführung Kolumbiens eingebrachte Resolution an, die die Einrichtung einer 19-köpfigen Expertengruppe vorsieht, um das Regelwerk der internationalen Drogenkontrolle zu überdenken und „to prepare a clear, specific, and actionable set of recommendations aimed at enhancing the implementation of the three drug conventions, as well as the obligation of all relevant international instruments, and the achievement of all international drug policy commitments.“ Zehn Mitglieder bestimmt die CND, fünf der Generalsekretär und drei das International Narcotics Control Board (INCB, der UN Suchtstoffkontrollrat zur Überwachung der Einhaltung der drei UN-Drogenkonventionen) und eines die Weltgesundheitsorganisation WHO. Dieser Beschluss reiht sich ein in eine Tendenz der allmählichen Öffnung der internationalen Drogenkontrolle, die ursprünglich fast vollständig von den USA dominiert war. So räumte die UN Sondergeneralversammlung zum Thema Drogen von 2016, bei deren Vorbereitung erstmals andere UN Unterorganisationen, wie die WHO oder das Hochkommissariat für Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Organisationen mitwirkten, größere „Interpretationsspielräume“ bei der Auslegung der drei UN Drogenkonventionen ein, um Desertionen vorzubeugen. NGO-Vertreterinnen machen nicht zuletzt ein „atemberaubend arrogantes Eingangsstatement“ und völlig unflexible Positionen ohne Verhandlungsbereitschaft der US-Delegation für das klare Votum der Delegierten verantwortlich. So wurden China, Kanada und Mexiko entgegen aller Gepflogenheiten direkt angegriffen und für die vielen Überdosis-Toten der US-Opioidkrise verantwortlich gemacht. Die kolumbianische Botschafterin Laura Gil in ihren Statement: „Alle Kolumbianerinnen und Kolumbianer verstehen und spüren, dass das globale Drogenproblem einen Schatten auf uns alle wirft, und dieses Forum ist eine Einladung, um unter dem Schirm der Konventionen das Prinzip der gemeinsamen und geteilten Verantwortung [für das Drogenproblem R.L.] jetzt und heute zu überdenken. Mein Land hat mehr Menschenleben geopfert als jedes andere in diesem Drogenkrieg, der uns aufgezwungen wurde. (…) Unsere besten Männer und Frauen und ein Löwenanteil unseres Budgets gingen in die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels. Wir brauchen neue und effektivere Mittel um ein globales System zu verwirklichen. Weiter zu machen wie bisher wird zu nichts führen.“ Ob diese Resolution tatsächlich einen Wendepunkt darstellen wird, muss ihre Umsetzung zeigen. Diese könnte, wie andere vielversprechende Ansätze, finanziellen Strangulierungen zum Opfer fallen. Laura Gil, die treibende Kraft dahinter, wurde am 5. Mai zur Stellvertretenden Generalsekretärin der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) gewählt und wird Wien verlassen. In der UNO-City kursieren Gerüchte und Spekulationen darüber, wie es mit den verschiedenen Unterorganisationen, wie etwa dem UNODC, weiter gehen könnte. Bei aller berechtigten Kritik an den Schwächen der Vereinten Nationen: Sie sind nur so stark wie ihre Mitgliedsländer es zulassen. Das Geschäft jener zu betreiben, die sie ohnehin schwächen oder abschaffen wollen, wäre abenteuerlich. * Food and Agriculture Organization (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Organisación Panamericana de Salud (OPS), Programa Mundial de Alimentos (WFP) und UNICEF: „El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024“ ** Neben dem erwähnten UNODC-Bericht auch: Israel Alvarado Martínez and Aitor Ibáñez Alonso: „Mexican Organized Crime and the Illegal Trade in Totoaba Maw“ in: Organized Crime 24, No. 4, 1st Dec. 2021 (https://doi.org/10.1007/s12117-021-09436-9)
Das hatte sich der wohl erfolgreichste Präsident, den Bolivien je hatte, anders vorgestellt. Das kleine Land im Herzen des Halbkontinents war nach seinem Erdrutschsieg Ende 2005 vielbeachteter Hoffnungsträger. Könnte die Entwicklung dort ein Vorbild sein? Nichts weniger als die „Neugründung Boliviens“ hatte man sich vorgenommen. Eine Regierung der sozialen Bewegungen wollte man sein. Bereits sechs Wochen nach Amtsantritt wurde ein Einberufungsgesetz zu einer verfassunggebenden Versammlung verabschiedet. Die neue Verfassung wurde dann 2009 – erstmals durch eine Volksabstimmung – angenommen. Bolivien wurde durch sie zum „plurinationalen Staat“. Soziale Rechte, Indígena-Rechte und die Rechte der Pachamama wurden darin festgeschrieben. Indigene Sprachen wurden auch Amtssprachen und die bunte Wiphala-Fahne gleichwertig neben die rot-gelb-grüne Nationalflagge gestellt. Die Nationalisierung der Kohlenwasserstoffressourcen vom 1. Mai 2006 spülte bei günstiger Konjunktur Devisen in die Staatskasse, die für eine Umverteilungs- und Sozialpolitik verwendet wurden. Die Armutsquote sank deutlich, die durchschnittliche Lebenserwartung stieg um Jahre. Ein bedeutender Teil der Unterschicht stieg in die untere Mittelschicht auf. Deren Binnennachfrage stabilisierte die Wirtschaft, auch als die Exporteinnahmen nach 2015 einbrachen. Grundlage war der Extraktivismus, insbesondere die Exporte von Erdgas. Grundlegende Strukturreformen unterblieben. Die Präsidentschaft von Morales war von einer Serie von Wahlen und Abstimmungen begleitet, was manche Beobachter als referenditis bezeichneten. Er hat sie alle mit absoluter Mehrheit gewonnen: eine bis dato in Bolivien unbekannte politische Stabilität. Nur nicht die beiden letzten... Heute sitzt Morales im Trópico de Cochabamba ohne Kandidatenstatus, ohne Partei, von einem harten Kern seiner Getreuen beschützt. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Sex mit Minderjährigen und Menschenhandel. Wie kam es dazu? Morales’ Fall Schon in seiner Zeit als Gewerkschaftsführer hat Morales Widersacher und Gegenkandidaten erfolgreich ausgeschaltet. Als Präsident wechselte er seine Minister in rascher Reihenfolge, servierte unter anderem seinen Mentor und Lehrmeister ab, den großen alten Gewerkschafter Filemón Escobar, und war sehr erfolgreich darin, die wichtigsten der vielen sozialen Bewegungen zu bedienen, die seine Regierung unterstützten. Die neue Verfassung vom Januar 2009 sieht in Art. 168 nur zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden vor. Ein Referendum zur Änderung dieses Artikels ging im Februar 2016 knapp verloren. Mitentscheidend waren damals Berichte eines „Enthüllungsjournalisten“ über ein gemeinsames außereheliches Kind des Präsidenten mit einer stets grell geschminkten Blondine, was dieser abstritt. Bilder von gemeinsamen Auftritten – etwa beim Karneval von Oruro – belegten demgegenüber zumindest eine gewisse Verbindung zwischen beiden und später wurde die Dame zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie hatte in dieser Zeit millionenschwere Regierungsaufträge für die chinesische Firma an Land gezogen, für die sie arbeitete. Der Ruf war angekratzt, doch wurden keine Spuren eines angeblichen Kindes gefunden. Politisch schlimmer wog, dass Morales das Ergebnis dieses Votums ignorierte und bei den Wahlen vom Oktober 2019 erneut kandidierte, was seinen Ruf als Demokrat nachhaltig beschädigte. Seine Popularität sank. Für die Opposition war klar: Es würde Wahlbetrug geben, das Regierungslager sah einen Putsch voraus. Die Wahlen brachten dann herbe Verluste von wahrscheinlich 14 Prozent, doch Morales gewann sie noch immer mit etwa 47 Prozent. Fraglich blieb, ob er 10 Prozentpunkte vor dem stärksten Oppositionskandidaten lag, wodurch eine Stichwahl vermieden würde. Als in der Wahlnacht die Schnellauszählung (nicht die amtliche!) angehalten wurde, nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Sechs von neun Departments-Wahlzentralen gingen in Flammen auf. Straßenproteste wurden wenige Tage später durch eine Polizeimeuterei befeuert. Schließlich legte der Armeechef Morales den Rücktritt nahe. Präsident und Vizepräsident gingen erst ins mexikanische Exil, dann nach Buenos Aires. Dorthin – so die heutige Anklage – sollen Morales immer wieder junge Mädchen zugeführt worden sein. Mit einer seinerzeit Fünfzehnjährigen soll er eine Tochter haben. Es war Hybris der Macht, mit der sich Morales selbst ins Abseits manövrierte. In Bolivien übernahm eine De-facto-Regierung, die von der politischen Rechten getragen wurde, von Korruption gekennzeichnet war und ohne Umschweife versuchte, den Prozess des Wandels, der seit 2006 stattgefunden hatte, rückgängig zu machen. Sie scheiterte an den Herausforderungen der Corona-Pandemie und politischen Ambitionen der Beteiligten. So wurde der Zweitplatzierte bei der Wahl von 2019, Carlos D. Mesa, praktisch ausgeschaltet. Vor allem aber erzwangen die machtvollen sozialen Bewegungen, die die MAS-Regierung stets getragen hatten, durch Straßenblockaden Neuwahlen, die dann im November 2021 die MAS mit 55,1 Prozent eindrucksvoll zurück an die Macht brachten. Vom argentinischen Exil aus hatte Morales seinen langjährigen Superminister für Wirtschaft und Finanzen, Luis Arce, als Spitzenkandidaten nominiert und seinen Intimfeind David Choquehuanca als Kandidat für die Vizepräsidentschaft. Der langjährige Außenminister hatte sich nach dem verlorenen Referendum vom Februar 2016 als Kandidat ins Spiel gebracht und war von Morales daraufhin auf einen Diplomatenposten ins „Exil“ befördert worden. Die Parteibasis hatte zuvor für Choquehuanca und Andrónico Rodríguez als Vize votiert, einen jungen politischen Ziehsohn Morales’. Nach dem Amtsantritt der Regierung Arce/ Choquehuanca kehrte Morales, vom argentinischen Präsidenten Alberto Fernández bis an die Grenze begleitet, im Triumphzug nach Bolivien zurück und versuchte sogleich, als Parteichef und Übervater weiterhin die Regierung zu lenken. Das konnte nicht gutgehen. Schon die Regionalwahlen von Anfang 2021 wurden – obzwar deutlich gewonnen – zum relativen Misserfolg. Es reüssierten oftmals Kandidaten und Kandidatinnen, die von Morales ausgebremst worden waren. Der jungen Eva Copa, die als Senatspräsidentin das Fähnlein der MAS gegen die De-facto-Regierung hochgehalten hatte während die Parteispitze im sicheren Exil saß, wurde vorgeworfen, mit der Regierung kooperiert zu haben. Eine Nominierung wurde ihr verwehrt. Sie wurde dann auf einer indigenistischen Liste mit 70 Prozent zur Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt, El Alto, gewählt. Stichwahlen gingen verloren und wurden teilweise durch MAS-Dissidenten gewonnen. Die MAS-internen Spannungen nahmen zu und regelmäßig wurden Präsident und Vizepräsident oder einzelne Minister von den sozialen Bewegungen zum Rapport einbestellt, die damals noch hinter Morales standen. Währenddessen versuchte die Opposition von ihrer Hochburg Santa Cruz aus fortlaufend, die Regierung durch „Bürgerstreiks“ zu destabilisieren, was das Land in Summe Milliarden kostete. Unter anderem war man gegen so triviale Dinge wie eine Volkszählung. Ein Fanal war die Aufforderung von Morales an „seine Regierung“ endlich in Sachen Volkszählung zu handeln – und zwar mit den Argumenten der Opposition. In dem Maße, wie die Kritik am Expräsidenten wuchs, der aus dem sicheren Exil heraus jene kritisiert hatte, die daheim für ihn den Kopf hingehalten hatten, wurde Morales’ Kritik an „seiner“ Regierung immer direkter und schriller. Morales warf ihr einen Rechtsruck und Paktieren mit der Opposition vor, nachdem man sich auf ein Verfahren zur Volkszählung geeinigt hatte. Zwölf Abgeordnete wurden aus der Partei ausgeschlossen, jegliche Kritik als „Verrat“ diffamiert. Als sich der junge Innenminister Eduardo del Castillo im Jänner 2022 „erdreistete“, Maximiliano Dávila zu verhaften, der unter Morales Chef der Spezialkräfte für den Kampf gegen den Drogenhandel gewesen war, nun aber von der DEA gesucht wurde und sich auf der Flucht nach Argentinien befand, wurde er neben Vizepräsident Choquehuanca und zusammen mit dem Justizminister zum Lieblingsfeind. Morales sprach von einem sinistren Plan gegen ihn und verlangte immer wieder deren Rücktritt. Man beschuldigte sich gegenseitig, mit dem Drogengeschäft unter einer Decke zu stecken. Als die MAS-Parlamentsfraktion zusammen mit der Opposition ein Amtsenthebungsverfahren gegen del Castillo durchsetzte, wurde er von Präsident Arce umgehend wieder berufen. Schließlich hatte er sich nicht nur aktiv gegen die Machtergreifung der Rechten 2019 gewehrt. Er hatte zusammen mit dem Justizminister auch dafür gesorgt, dass die maßgeblich Verantwortlichen vor Gericht gestellt wurden, darunter eine ganze Reihe hoher Militärs. Selbstdemontage der MAS Im Oktober 2023 war das Band zerrissen. Es gab bereits zwei MAS-Parlamentsfraktionen und auch die sozialen Bewegungen waren in „evistas“ und „arcistas“ gespalten. Morales berief einen Parteitag in seiner Hochburg im Kokaanbaugebiet des Tropico de Cochabamba ein, wo sich der lider indiscutible zwei Jahre vor den Wahlen zum Parteichef wiederwählen und vorzeitig zum Spitzenkandidat küren ließ. Dass Arce und Choquehuanca nicht kamen wurde als „Selbstausschluss“ gewertet. Freilich wurde der Parteitag als solcher wegen Verfahrensfehlern bei der Einberufung vom Wahlgerichtshof nicht anerkannt. Der Oberste Gerichtshof untersagte Morales schließlich mit einer abenteuerlichen Auslegung der Verfassung überhaupt die Kandidatur, weil er schon zweimal Präsident war. Diese spricht freilich für diesen Fall wie gesagt von aufeinanderfolgenden Amtsperioden. Die „evistas“ erkennen das Urteil nicht an, weil die Amtszeit der Richter bereits abgelaufen war. Eine Neuwahl der Verfassungsrichter war wegen der Pattsituation im Parlament nicht möglich gewesen. Im Mai 2024 wählten die „arcistas“ auf „ihrem“ Parteitag in El Alto mit Unterstützung des ihnen nahe stehenden „Einheitspakts“ der sozialen Organisationen den Bauerngewerkschafter (CSUTCB) Grover García zum Parteichef der MAS. Die „evistas“ protestierten dagegen mit Märschen und Straßenblockaden, die teilweise gewalttätig verliefen und sukzessive an Zulauf verloren. Auch sie dürften Milliardenschäden für die Volkswirtschaft verursacht haben. Präsident Arce hielt sich derweil vornehm zurück: Es sei die Zeit zu arbeiten. Für eine Kandidatenwahl sei es zu früh, gab er den fleißigen Administrator. Ein Volkstribun ist er ohnehin nicht. Dafür verfügt er als Präsident über die Mittel, seine Gefolgschaft bei der Stange zu halten. Woher Morales sie nimmt, ist nicht bekannt. Dabei steckt Bolivien in einer ernsten Wirtschaftskrise. Dollars sind knapp. Zeitweise muss händeringend Diesel importiert werden und die Lähmung des Transportsektors befeuert die Inflation. Ersatzinvestitionen wurden lange vernachlässigt. Die Regierung gibt die Schuld der Blockade der „evistas“, die im Parlament zusammen mit der Opposition Gesetze und Kreditbewilligungen blockierten. Die Devisenreserven fallen schon seit 2015 und liegen mit 1,9 Mrd. US-Dollars (USD; entspricht 4 Prozent des PIB) auf dem niedrigsten Stand seit 2005. Ein Bericht der UN Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) listet Bolivien unter den Ländern mit dem niedrigsten Wachstum und der höchsten Inflation auf. Präsident Arce wurde in der öffentlichen Wahrnehmung vom Architekten des bolivianischen Wirtschaftswunders zum Versager. In Umfragen liegt er bei 5 Prozent, während Morales immerhin noch rund 20 Prozent zugeschrieben werden. Ein bolivianischer Elon Musk? Was diese Umfragen wert sind, ist die Frage. Am meisten Aufmerksamkeit genossen jene, die von Marcelo Claure in Auftrag gegeben wurden, einem Selfmade-Unternehmer und Besitzer von Fußballclubs in Bolivien und den Vereinigten Staaten. Er strebe selbst kein Regierungsamt an, sagt er, wolle aber gerne helfen, Bolivien aus der Krise zu führen. Hauptsache, die Herrschaft der MAS ende. Aber Andrónico wäre noch immer besser als ein Pädophiler (Morales) oder ein Unfähiger (Arce): „Andrónico es mil veces mejor que un pedófilo o un incapaz y tengo mucha fé que todos trabajaremos juntos para sacar a Bolivia de este hueco“. Seine politische Präferenz liegt rechts der Mitte. Dort tritt eine Reihe von Altpolitikern an. Manfred Reyes Villa, 2021 mit 59 Prozent erneut zum Bürgermeister von Cochabamba gewählt, kommt ursprünglich aus dem Umfeld der ADN von Exdiktator Hugo Banzer. Er gilt als ebenso effizienter wie korrupter Administrator. Nach der Machtübernahme der MAS 2006 musste er mit einem halben Dutzend Korruptionsverfahren im Gepäck außer Landes fliehen. Daneben scheint eine Rechtsallianz, die hauptsächlich aus Drahtziehern der 2019 eingesetzten „Interimsregierung“ bestand, mit dem Ausscheiden von „Tuto“ Quiroga zerbrochen. Ihr wurden rund 20 Prozent prognostiziert. Quiroga war nach dem Krebstod von Hugo Banzer als dessen Vize von August 2001 bis August 2002 schon einmal zum Präsident aufgerückt. Er gilt als Schlüsselfigur jener illustren Runde, die nach der Flucht von Morales 2019 in der Universidad la Católica die Strippen für die Einsetzung der „Interimsregierung“ zog. Frontmann ist nunmehr der Zementunternehmer Samuel Doria Medina, der bereits 1992 unter dem sozialdemokratischen Präsidenten Jaime Paz Zamora einmal Planungsminister war. Er gilt als liberal-gemäßigt. Ebenso wie Carlos D. Mesa der Zweitplatzierte bei den Wahlen vom Oktober 2019, vormals ein honoriger Journalist und Historiker, der jedoch wegen seiner Rolle bei den Novemberereignissen von 2019 als „verbrannt“ gilt. Mit von der Partie ist aus dem Gefängnis Chonchocoro heraus auch Fernando Camacho, Organisator der Blockadeaktionen von Santa Cruz gegen die Regierung Arce, der sich damit brüstet, dass sein Vater 2019 die Polizei geschmiert und zur Rebellion angestiftet hat. Er wurde deshalb am 28. Dezember 2022 verhaftet. Im Umfeld der Überreste der seinerzeit von Hugo Banzer gegründeten ADN geistert ferner der notorische Speiseöltycoon Branco Marincovic herum, der bereits beim Zivilputsch von Santa Cruz 2008 die Fäden zog. Bolivien hat eine sehr junge Bevölkerung. Viele Wählerinnen und Wähler sind unter 30 Jahre alt und dürften sich kaum noch an die erfolgreichen ersten Jahre der Morales - Regierung erinnern, geschweige denn an das voraus gegangene Chaos und die damit verbundenen politischen Dinosaurier. Eine wichtige Rolle dürfte die Präsenz in den sozialen Medien spielen. Der Faktor Andrónico Politologen sprechen von einem dysfunktionalen Parteiensystem. Die einzige Partei mit nationaler Reichweite und Verankerung ist die MAS – und selbst die hatte vor den Regionalwahlen 2021 Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden. Die Finanzierung ist ein großes Problem. Man ist in einer Partei, weil man im Falle ihres Wahlsiegs auf einträgliche Posten hofft. Umgekehrt suchen sich Persönlichkeiten eingetragene Wahlkürzel, die sich mitunter sogar in Familienbesitz befinden und vermietet werden. Morales etwa ist aktuell verzweifelt auf der Suche nach so einer "Taxipartei". Ferner will er mit einem Marsch auf La Paz seine Kandidatur erzwingen. Ebenfalls auf der Suche nach einer „politischen Heimat“ ist Andrónico Rodríguez. Der 36-jährige Senatspräsident stammt aus Morales’ Kernland im Trópico und wurde von ihm als potenzieller Nachfolger aufgebaut. Lange führte er im Parlament die Fraktion der „evistas“ an, war dabei aber eher moderat und besonnen. Nach langem Zögern ist er nun vielfachen Rufen nach einer politischen Frischzellenkur nachgekommen und hat erklärt, dass er kandidieren wolle. Die „evistas“ sprachen umgehend von Verrat. Er steht für eine Fortführung des proceso de cambio und der bäuerlich-plebejischen Orientierung, kommt mit seiner Dialogbereitschaft aber auch bei den städtischen Intellektuellen an. Nun sucht der erklärte Kandidat nach einer Partei. Noch ist nicht abzusehen, wohin die Reise geht. In Frage kommen das Movimiento Tercer Sistema von Felix Patzi, der einmal Bildungsminister unter Morales war und gefeuert wurde oder das Movimiento de la Renovación Nacional der Bürgermeisterin Eva Copa, denen er erst Statur geben könnte. Oder ist Andrónico die letzte Chance für die MAS? Die hatte nach der Kandidatur von Andrónico Rodríguez einen Parteitag, auf dem Luis Arce zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben und Präsident Arce erklärte daraufhin, er würde nicht kandidieren und forderte Morales auf, es ihm gleich zutun. Beides vergeblich: Rodríguez wollte nicht für die "arcistas" kandidieren. Nachtrag (26.5.) nach Registrierungsschluss Der Nationale Wahlgerichtshof gab nunmehr folgende Kandidatenlisten bekannt: Nueva Generación Patriótica (NGP): Präsidentschaftskandidat Jaime Dunn mit Vizepräsidentschaftskandidat Édgar Uriona Partido Demócrata Cristiano (PDC): Rodrígo Paz mit Edman Lara Frente Izquierda Revolucionaria (FIR) y Demócratas: Jorge Quiroga mit Juan Pablo Velazco Unidad Nacional (UN) y Creemos : Samuel Doria Medina mit José Luis Lupo APB – Sumate : Manfred Reyes Villa mit Juan Carlos Medrano Libertad y Progreso/ ADN : Paulo Folster mit Antonio Saravia Fuerza del Pueblo : Jhonny Fernandez mit Felípe Quispe Aus der (noch) Regierungspartei MAS gingen letztlich drei Listen hervor: Movimiento al Socialismo (MAS): Eduardo del Castillo und Milán Berna (aus der Bauerngewerkschaft CSUTCB) Movimiento de Renovación Nacional (MORENA): Eva Copa mit Jorge Richter (vormals Regierungssprecher von Präsident Arce) Alianza Popular/ MTS : Andrónico Rodríguez mit Mariana Prado (von 2017-2019 Planungsministerin unter Morales; gegenwärtig läuft noch ein Verfahren, ob das Movimiento Tercer Sistema von Felix Patzi die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt) Evo Morales hat seine ehemalige Ministerin für Kultur und Tourismus (2017-2019), Wilma Alanoca, als Vizepräsidentschaftskandidatin vorgesehen und kämpft mit einem für heute (26.5.) angekündigten Marsch auf La Paz weiterhin um nachträgliche Zulassung.

Beim Thema Migration haben die Trump-Dekrete bereits Verzweiflung ausgelöst. Als „scary“ (erschreckend oder beängstigend) beschreibt unsere Kollegin Coletta Youngers, die bis vor Kurzem jahrzehntelang für das Washington Office on Latin America (WOLA) gearbeitet hat, die Atmosphäre seit der Amtseinführung des 47. Präsidenten. In ihrem Stadtviertel wohnen viele Migranten, die sich fragen, was mit den angekündigten Razzien auf sie zukommt. Beängstigend ist auch die umgehende Begnadigung der Teilnehmer des Sturmes auf das Kapitol, knapp 1.600 Angeklagte beziehungsweise Verurteilte, darunter Führer und Mitglieder der paramilitärischen und rechtsradikalen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“, die wegen schwerer bis schwerster Delikte vor Gericht kamen, zum Beispiel Enrique Tarrio, Vorsitzender der „Proud Boys“, der wegen Verschwörung zu 22 Jahren Haft verurteilt worden war. Die nachträgliche Legitimierung eines Putschversuchs durch den Anstifter? Seinerseits scheinbar legitimiert durch das aktuelle Wahlergebnis, was die Sache eher schlimmer macht als besser. Beängstigend auch der sofortige Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein klares Bekenntnis gegen den Multilateralismus in einer Zeit multipler Krisen. „America First“, bedeutet das für Lateinamerika die Rückkehr zur Monroe-Doktrin, wonach der Halbkontinent exklusives Einflussgebiet oder Hinterhof der Vereinigten Staaten sind? Jedenfalls wird Lateinamerika an Aufmerksamkeit gewinnen. Zuletzt spielte der Halbkontinent im Süden eine eher geringe Rolle in der US-Außenpolitik, die dort auf Krisen wie Migration und Drogen bezogen war und sich sonst um andere Regionen kümmerte. Während in der ersten Amtszeit Trumps wichtige Posten, wie der des zuständigen Undersecretary for Western Hemispheric Affairs im State Department, monatelang unbesetzt blieb, legen das schon die Personalentscheidungen nahe. Außenminister wird mit Marco Rubio ein exilkubanischer Hardliner, sein Stellvertreter wird Christopher Landau, der Botschafter in Mexiko war. Schon im Vorfeld wurden Mitarbeiter des State Departments ausgetauscht und durch Getreue ersetzt. Nicht zuletzt wurden eine Reihe von Botschaftsposten in lateinamerikanischen Staaten umbesetzt. Mit Mauricio Claver-Carone wurde ein weiterer Exilkubaner, Hardliner und Sanktionsbefürworter Sonderbeauftragter für Lateinamerika. Schon während seiner ersten Amtszeit war Trump dafür bekannt, unterschiedliche Positionen gegeneinander auszuspielen. Sondergesandter – unter anderem für Venezuela – wurde mit Richard Grenell ein weiterer bekannter Hardliner, vormals Botschafter in Berlin, doch er ist mehr „Freihändler“ als Sanktionsbefürworter. Zentrale Themen dürften neben Migration und Drogen nun auch der Kampf um Rohstoffe und gegen die chinesische Dominanz sein. Hier kommt der omnipräsente Elon Musk ins Spiel, der als Autobauer direkte Interessen am Lithium-Dreieck (Argentinien, Bolivien, Chile) hat. Im WOLA erwartet man insgesamt deutliche Rückschritte bei demokratischen Normen, Räumen für die Zivilgesellschaft, dem Schutz der Minderheitenrechte, der Unabhängigkeit der Justiz, bei Initiativen für Inklusion und Vielfalt, Minderheitenrechten und beim Klimaschutz. Die Nähe zu autoritären Führern, wie Javier Milei (Argentinien), Nayib Bukele (El Salvador) oder der Bolsonaro-Familie könnte anti-demokratische Elemente in der Region beflügeln und demokratische Institutionen, bürgerliche Freiheiten und Sicherheiten sowie den Schutz der Menschenrechte in Frage stellen. Ein Sohn Bolsonaros gilt als Schlüsselfigur für die Vernetzung der lateinamerikanischen mit der internationalen Rechten und Jair Bolsonaro rief seine Anhänger zu Massendemonstrationen gegen die Einschränkungen für Musks Plattform X auf. Zur Amtseinführung konnte er nicht kommen. Wegen laufender Verfahren ist er mit einem Ausreiseverbot aus Brasilien belegt. Thema Migration Die Bekämpfung der Migration war und ist ein Trump’sches Kernthema. Er sieht sie gerne als gezielten Versuch (von wem eigentlich?) die Vereinigten Staaten zu schwächen. Migranten bezeichnet er als Terroristen, Vergewaltiger, Gesindel, Verbrecher und drohte mit der größten Abschiebungswelle, die die Welt gesehen hat. Dadurch werden vor allem Mexiko und die mittelamerikanischen Länder unter massiven Druck geraten und die Beziehungen belastet. Unter Androhung von Strafzöllen durchgesetzte Zwangsabschiebungen in Rambo-Manier gaben einen Vorgeschmack. Auch unter Biden war die Migrationspolitik restriktiv, aber durch bestimmte Schutzmechanismen – Temporary Protection Status etwa für Kinder oder Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela – abgemildert. Nun sollen flächendeckende Razzien, auch in Spitälern und Kirchen, sowie Massendeportationen durchgeführt werden. Grenzkontrollen sollen weiter militarisiert und Grenzbefestigungen ausgebaut werden. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat angekündigt, ihre Landsleute schützen zu wollen, etwa durch Rechtsbeistand über die Konsulate. Von den angedrohten Abschiebevorhaben sind potenziell vier Millionen Menschen aus Mexiko betroffen, zwei Millionen aus Mittelamerika, mehr als 800.000 aus Südamerika und 400.000 aus der Karibik. Rhetorischer Theaterdonner und Symbolpolitik also? Jenseits des dafür bewusst in Kauf genommenen menschlichen Leids und persönlicher Katastrophen: Weder für die abschiebenden Behörden noch für die Länder, die sie aufnehmen sollen dürfte das überhaupt auch nur annähernd zu leisten sein. Mehr noch: Nicht nur für Kuba, für eine ganze Reihe krisengeplagter Volkswirtschaften sind Familienüberweisungen der wichtigste oder zumindest ein wichtiger Devisenbringer. In Guatemala, Honduras und El Salvador entsprechen sie jeweils etwa einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Thema Drogen In der puritanistischen Einwanderergesellschaft waren „Drogen“ stets als besonders gravierendes und meist als von Außen in den „gesunden Gesellschaftskörper“ hereingetragenes Problem wahrgenommen worden. Die USA waren es auch, die mit der Haager Konvention von 1912 das erste internationale Drogenabkommen überhaupt forciert hatten. Seitdem Präsident Richard Nixon den Drogen im Jahr 1972 „den Krieg“ erklärte, war es über Parteigrenzen hinweg ein politisches Tabu soft on drugs zu erscheinen. Während der Präsidentschaft von Ronald Reagan kamen in den 1980er Jahren die südamerikanischen Produzentenländer von Kokain in den Focus, das als Hauptproblem angesehen wurde. Going to the source hieß die Devise. Während innenpolitisch in den letzten Jahren stärker differenziert und mehr Gewicht auf gesundheitspolitische Ansätze gelegt wurde, hat sich bei der Externalisierung der Drogenpolitik wenig geändert. Nur Weltpolizist Uncle Sam verfügt seit 1978 über ein Büro für internationale Drogen- und Gesetzesvollzugsangelegenheiten im Außenministerium, dessen Budget stets erheblich über dem des entsprechenden Pendants bei den Vereinten Nationen (UNDCP) liegt; hinzu kommen einschlägige Budgets, etwa im Pentagon.* Doch der jahrzehntelange, teilweise militarisierte Drogenkrieg ist bei hohen sozialen und ökologischen Kosten gescheitert. Die Produktion von Kokain (Bolivien, Kolumbien, Peru) ist auf Rekordniveau. Begleiterscheinung der militarisierten Drogenbekämpfung waren ausufernde Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Doch heute steht nicht mehr das pflanzenbasierte Kokain im Vordergrund, sondern das synthetisch hergestellte Fentanyl, das aus Mexiko kommt. Seit 2008 sind mehr als eine Million Menschen in den USA an Überdosen des starken Opioids Fentanyl gestorben. Nach Jahren stetigen Anstiegs geht ihre Zahl aktuell zurück. Während Trumps erster Amtszeit hatte sie sich vervierfacht. Die Biden-Administration hatte darauf mit einem Bündel von Maßnahmen der harm reduction (Schadensminderung) reagiert, während die Republikaner traditionell eher auf das Strafgesetzbuch setzen. Trump hat angekündigt, mexikanische Drogenorganisationen als Terrorgruppen einzustufen und bedroht die mexikanische Regierung mit Strafzöllen, um sie „zum Handeln zu zwingen“. In republikanischen Kreisen wurden darüber hinaus Militäreinsätze in Mexiko, einschließlich der US Special Forces angedacht. Die mexikanische Regierung dürfte über diesen Unilateralismus alles andere als begeistert sein, selbst wenn es im Endeffekt nicht so weit kommen sollte. Es drohen Gegenzölle und ein Handelskrieg zu beiderseitigem Nachteil. Gefragt wäre vielmehr Kooperation bei der Stärkung des Justizsystems und bei der Korruptionsbekämpfung. Der Fall Venezuela Hier darf man eine Rückkehr zur Politik der ersten Amtsperiode Trumps erwarten. Am Tag vor der Amtseinführung des selbsterklärten Wahlsiegers Nicolás Maduro benannte Donald Trump in einem Post dessen Gegenspieler Edmundo Gonzáles Urrutia als Präsident und lobte die Unterstützung für ihn durch die venezolanische Community in den USA. Marco Rubio sagte in seiner Anhörung als designierter Außenminister vor dem Kongress, das Land sei von kriminellen Organisationen und Drogenhändlern kontrolliert und kritisierte die Biden-Regierung für die Lockerung von Sanktionen. Trumps designierter Sicherheitsberater Michael Waltz traf Gonzáles Urrutia (noch in seiner Eigenschaft als Kongressabgeordneter für Florida) bei dessen Besuch in Washington. Dieser wirbt mit dem Argument, dass nach einem Systemwechsel Millionen Flüchtlinge freiwillig nach Venezuela zurückkehren würden. Maduro wiederum dürfte an einer Verlängerung der Öl-Lizenzen interessiert sein und könnte im Gegenzug bei publikumswirksamen Abschiebeflügen kooperieren. Venezuela ist der drittgrößte Öllieferant für die USA (2024) und Trump braucht Öl zur Reduzierung der Energiekosten („ drill baby drill“ ). Hier kommt der „Freihändler“ Richard Grenell ins Spiel, der bereits in der Vergangenheit mit Maduro verhandelt hat. Der Fall Kolumbien Kolumbien ist traditionell der wichtigste Verbündete der USA in der Region, die wichtigste Auffang- und Durchgangsstation für Migranten aus Venezuela und priorisiert den Handel mit den USA vor dem mit China – auch unter der Linksregierung von Präsident Gustavo Petro. Die USA haben dort im Rahmen des Drogenkriegs sieben Militärbasen. Zwar ist seit dem Friedensabkommen mit den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC) von 2016 die Gewalt im Land deutlich reduziert. Wichtig wäre heute Unterstützung beim Ausbau rechtsstaatlicher Präsenz in den von den FARC verlassenen Gebieten und die Bekämpfung der Konfliktursachen. Doch weiterhin bekämpfen sich die noch aktive Guerilla ELN ( Ejército de la Liberación Nacional ), FARC-Dissidenten (zuletzt in der Region Catatumbo, wo es um Transitrouten für Kokain geht), rechtsextreme Paramilitärs untereinander – und mit dem Militär. Alle zusammen werden sie GAI ( Grupos Armados Ilegales ) genannt und diese Gruppen kontrollieren einen Großteil der Kokainproduktion, die in Hochproduktivitätszonen vor allem im Süden Kolumbiens konzentriert ist und auf historischem Rekordniveau liegt. Hier bieten sich Kooperationsmöglichkeiten. Größer scheint jedoch die Gefahr, dass die Trump-Regierung auf die alten martialischen Strategien setzt und es darüber zu Auffassungsunterschieden mit der Regierung von Gustavo Petro kommt, die man bereits mit der Erpressung von Zwangsabschiebungen brüskiert hat. Schließlich hatte man bis vor zehn Jahren unter US-Regie in großem Stil Kokafelder mit Pflanzengift aus der Luft besprüht. Der Fall Zentralamerika Zentralamerika ist neben Mexiko die wichtigste Heimat von Migranten, die in die USA kommen. Die betroffenen Länder dürften mit der angedrohten Abschiebungspraxis unter erheblichen Druck geraten. Hierzu hat man in Washington noch keinerlei spezifische Maßnahmen definiert, doch dürfte eine Abkehr von der langfristig angelegten, proaktiven Politik der Ursachenbekämpfung erfolgen, für die Vizepräsidentin Kamala Harris zuständig war. Gewalt ist die wichtigste Fluchtursache dort. Durch Massenabschiebungen dürften Gewalt und Chaos zunehmen. So werden keine Probleme gelöst, sondern neue geschaffen. Politisch könnte Präsidentin Xiomara Castro in Honduras wegen ihrer Beziehungen zu Venezuela, Kuba, Nicaragua und China unter Druck geraten. Das Trump-Lager hatte ferner enge Beziehungen zu Leuten unterhalten, die in Guatemala wegen Korruption sanktioniert wurden. Sie könnten Frühlingsluft wittern. Der Fall Kuba Unter dem Druck des nunmehrigen Außenministers Marco Rubio hatte Trump in seiner ersten Amtszeit die Tauwetter-Politik unter Präsident Obama aufgehoben, neue Sanktionen verhängt, gemeinsame Arbeitsgruppen – etwa zu Migration, Menschenrechten und Umwelt – aufgelöst und Kuba wieder auf die Liste der Staaten gesetzt, die Terror unterstützen. Einige dieser Maßnahmen wurden von der Biden-Regierung aufgehoben. Die Streichung Kubas von der „Terrorliste“ erfolgte erst nach der Freilassung von 553 Inhaftierten kurz vor Ende seiner Amtszeit und wurde nun von Trump umgehend wieder rückgängig gemacht. Mit dem Exilkubaner Marco Rubio und anderen Hardlinern in Schlüsselpositionen dürfte sich die sowieso schon sehr begrenzte Entspannung der Beziehungen erledigen. Möglicherweise liegt in der Migration ein Anknüpfungspunkt für politischen Pragmatismus, die mit der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf der Insel seit 2022 auf Rekordhöhe liegt. Thema WHO Die Weltgesundheitsorganisation WHO mit Sitz in Genf bedauert in einem Statement den Austritt der USA. Mit 8.000 Beschäftigten ist sie die größte UNO-Unterorganisation. Sie wurde am 7. April 1948 zu dem Zweck gegründet, sich für „bestmögliche Gesundheit für alle“ einzusetzen. Zu ihren Erfolgen gehört der Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Polio und Pocken. Für viele Länder, gerade im globalen Süden, sind ihre Frühwarnungen, Koordination und Notfallfonds im Ernstfall lebenswichtig. Mit 18 Prozent sind die USA der größte Beitragszahler zum WHO-Budget. Der Austritt muss gegenüber dem UNO-Generalsekretär Guterres noch schriftlich erklärt werden, dann dauert es ein Jahr bis er wirksam wird. Thema Klima Die Klimakrise führt immer schneller zu immer mehr Katastrophen. Das zeigen zuletzt auch die verheerenden Brände in Kalifornien, für die Trump nur mangelhaften Katastrophenschutz verantwortlich macht. Allein im bolivianischen Amazonien sind im letzten Jahr 10 Millionen Hektar – eine Fläche größer als Österreich – abgebrannt (2023 waren es „nur“ 6,3 Millionen Hektar), während das Land nun, zur Regenzeit, unter Überschwemmungen leidet. Für Donald Trump ist die Klimakrise aber eine „Erfindung“ und er hat folgerichtig den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt, das mit seinem ohnehin inzwischen außer Reichweite geratendem 1,5 Prozent-Ziel am 12. Dezember 2015 beschlossen wurde. Ganz im Sinne der kurz vorher beschlossenen Agenda 2030, den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Eine weitere Abkehr vom Multilateralismus. Was sonst? Außenminister Marco Rubio hat alle Hilfsprogramme eingefroren. Es wird geprüft, ob sie in Trumps Konzept passen. Einschlägige Kooperationsprogramme zum Minderheitenschutz, Gender, Anti-Rassismus stehen ebenso zur Disposition wie die Unterstützung der in dieser Richtung aktiven NGOs. So erwartet etwa das WOLA die Rückkehr zur sogenannten Mexiko-City-Politik, die US-Hilfen an Organisationen untersagt, die Abtreibung befürworten, um nur ein Beispiel zu nennen. Der US-kolumbianische Anti-Rassismus-Aktionsplan könnten dem zum Opfer fallen. Für die nächsten zwei Jahre wird Trump eine republikanische Kongressmehrheit zur Durchsetzung seiner Politik hinter sich haben. Lateinamerika muss steifen Nordwind im Sinne der Unterstützung autoritärer Strömungen, Menschenrechtsprobleme sowie wirtschaftliche und geostrategische Herausforderungen befürchten. Geopolitik des Zugangs Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine ist die Geopolitik zurück auf der Agenda. Dabei hat Trump – neben den Drohungen an China – zuletzt Kopfschütteln ausgelöst, indem er ankündigte, Kanada als 51. Bundesstaat integrieren und Grönland kaufen sowie den Panama-Kanal notfalls militärisch besetzen zu wollen: „Make America Great Again“. Der in den USA geborene und emeritierte Politologe der Uni Wien, Mitchell Ash, unterscheidet im Trump-Team Erzkonservative, Milliardäre und Verrückte – und vielfach wurden die geopolitischen Begehrlichkeiten als verrückt abgetan. Ganz so einfach ist es nicht. Trump liebt es Drohkulissen und Druck aufzubauen. Ein weiteres Abschmelzen der Arktis würde neue Routen für die Schifffahrt eröffnen und den Seeweg von Westeuropa nach Asien um zwei Wochen verkürzen. Kontrollieren lassen sie sich von Grönland aus, das zum EU-Mitglied und NATO-Partner Dänemark gehört. Das Trump’sche Getöse mag in einem ersten Schritt Abspaltungstendenzen beflügeln. Über den Panama-Kanal laufen 5 Prozent des Welthandels. Besonders wichtig ist er für die Verbindung der US-Westküste nach Asien. Die USA sind auch stärkster Nutzer mit 40 Prozent der transportierten Container, vor China (21) und Japan mit 14 Prozent. Überhaupt ist der Kanal als solcher ein Produkt des US-Imperialismus. Nach einer militärischen Intervention wurde Panama im Jahr 1903 von Kolumbien abgespalten und noch im gleichen Jahr wurde der Vertrag zum Bau des Kanals unterzeichnet, der dann 1914 fertig gestellt wurde. Panama war mit der Howards Air Force Base bis 1999 das Hauptquartier des für Südamerika zuständigen Southern Command der US-Streitkräfte. Im gleichen Jahr wurde der Kanal aufgrund der Carter-Torrijos-Verträge von 1977 an Panama übergeben. Heute werden an beiden Enden des Kanals die Häfen von einer Tochter der CK Hutchinson Holding mit Sitz in Hong Kong bewirtschaftet, was nicht nur Trump beunruhigen dürfte, zumal es im vergangenen Jahr 2024 wegen Wassermangel zu ernsten Behinderungen und Gerangel um die Passagen kam. Gleichzeitig wurde durch den Beschuss der Huthi-Rebellen auch der Verkehr durch den Suez Kanal behindert. Damit nicht genug wurde im November 2024 durch die peruanische Präsidentin Dina Boluarte, deren linker Vorgänger im Dezember 2022 durch einen kalten Putsch ins Gefängnis befördert worden war, der Hafen Chancay bei Lima eröffnet. Die Eröffnung erfolgte im Beisein des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Die staatliche chinesische Schifffahrtsgesellschaft COSCO hatte 3,4 Milliarden USD investiert. Der Sonderbeauftragte Claver-Carone trat mit dem Vorschlag hervor, Waren, die den Hafen von Chancay durchlaufen, mit 60 Prozent Zoll zu belegen. Zusammen mit Argentinien bauen die USA ihrerseits in aller Stille an einer gemeinsamen Marinebasis in Ushuaia, dem Tor zur Antarktis, wie bei einem gemeinsamen Besuch der Southcom Chefin Generalin Laura Richardson, dem US Botschafter und Präsident Javier Milei im April 2024 deutlich wurde. Nach Verlegung des Southcom aus Panama war die Basis auf dem ecuadorianischen Flughafen Manta (1999-2009) das Zentrum der militärischen US-Aktivitäten in Südamerika. Die Verträge wurden jedoch vom damaligen Präsidenten Rafael Correa nicht verlängert. Der aktuelle ecuadorianische Präsident Daniel Noboa würde sie gerne erneuern, was inzwischen aber gegen die Verfassung verstieße. Ferner braucht er die Unterstützung Washingtons bei seiner Politik der harten Hand im Kampf gegen den Drogenhandel, womit er im Weißen Haus offene Türen einrennen dürfte. Generalin Laura Richardson war es auch, die sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich um den Verlust der Kontrolle in Sachen Rohstoffe zu Gunsten Chinas sorgte. Hier geht es insbesondere um Kupfer und Lithium. Beides braucht man für Elektroautos und Tesla-Chef Musk dürfte ein massives Interesse am Lithium-Dreieck Argentinien, Bolivien, Chile haben. Chile ist vor Peru auch der weltgrößte Kupferproduzent. Die weltweit größten Lithium-Reserven liegen in Bolivien. Am 12. Dezember 2018 war in Berlin im Beisein des bolivianischen Außenministers und des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier ein Joint Venture zur Lithiumgewinnung gegründet worden. Bis zum November 2019 saß der beteiligte baden-württembergische Mittelständler auf unterschriftsreifen Verträgen, die dann auf Eis gelegt wurden, was zu Spekulationen über eine Beteiligung von Mitkonkurrenten am seinerzeitigen Sturz der Regierung Morales Anlass gab, zumal Elon Musk, darauf angesprochen, in seiner bekannt flapsigen Art später sagte: „Wir stürzen wen wir wollen.“ Zweifellos hätte er die finanziellen Mittel dazu. Sicher ist, dass es auch innerhalb Boliviens Widerstände gegen die Verträge gab. Nachdem eine demokratisch gewählte Regierung Ende 2020 die Regierungsgeschäfte in La Paz übernahm wurden auch Verhandlungen wiederaufgenommen, an denen aber kein europäisches Land mehr beteiligt war, was möglicherweise der zweifelhaften Rolle des damaligen EU-Botschafters León de la Torre bei der Machtergreifung der politischen Rechten geschuldet ist. Investiert haben inzwischen chinesische und ein russisches Unternehmen im bolivianischen Salar de Uyuni. Nicht nur im Lithium-Dreieck hat China die USA überholt. Chinas Handelsvolumen mit Lateinamerika ist zwischen 2000 und 2022 von 12 auf 485 Milliarden USD gestiegen. Stark gewachsen ist auch die Bedeutung chinesischer Kredite. Für Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ist China der wichtigste Handelspartner. Drängen die USA unter Trump nun in ihren alten Hinterhof – gemäß der Monroe-Doktrin von 1823 – zurück? Diese war mit ihrem „hands off Latin America“ gegen den europäischen Imperialismus gerichtet. Heute könnte es darum gehen, Terrain zurück zu gewinnen. Allzu großes Gepolter dürfte dabei nicht hilfreich sein, zumal die progressiven Länder heute besser untereinander vernetzt sind und mit China eine mächtige Alternative haben. So erfolgten beispielsweise auf die aktuellen Drohungen gegen Mexiko und Panama umgehend Solidaritätsbekundungen aus dem Süden. Während die Lateinamerikaner auf Diversifizierung ihrer Beziehungen setzen, hat Europa ihre Avancen stets eher verpuffen lassen und ist im außenpolitischen „Beiwagerl“ Washingtons sitzen geblieben, wo Präsident Trump nun wieder mit der Abkoppelung droht. Wie auch immer: Vieles von dem, was Trump mit Pauken und Trompeten ankündigt, wird sich so gar nicht umsetzen lassen und könnte letztlich auch für die Vereinigten Staaten und seine Oligarchen selbst kontraproduktiv sein. Ungeachtet dessen dürften damit große Probleme für Lateinamerika verbunden sein. Wie ein Blick auf Lateinamerika zeigt: Das Liebäugeln mit dessen Politikstil sowie unilaterale und autoritäre Ansätze führen in die Sackgasse und schaffen mehr Probleme als sie lösen. In einer Zeit multipler und sich verschärfender Krisen ist damit zusätzlich die Gefahr zunehmender Konflikte und eines Abgleitens in den Faschismus verbunden. * Näheres siehe Lessmann, Der Drogenkrieg in den Anden, Wiesbaden, 2016; Bureau for International Narcotics Matters and Law Enforcement Affairs ; UNODC United Nations Office on Drugs and Crime.

Es scheint, als ob die Regierung von Nicolás Maduro trotz offensichtlicher Wahlfälschungen, breiter Proteste und internationaler Kritik, z um B eispiel von den Regierungen Kolumbiens, Chiles und Brasiliens, an der Macht bleiben kann. Wie siehst Du die Situation heute in Venezuela? Die aktuelle Situation in Venezuela ist durch das Zusammenwirken verschiedener Ereignisse gekennzeichnet. Erstens haben der Wahlbetrug vom 28. Juli und die Geschehnisse rund um die Wahl die venezolanische Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Die Wahlbeteiligung war mit 73 Prozent sehr hoch. Unabhängige Wahlbeobachter:innen achteten darauf, dass es keine Unregelmäßigkeiten gab. Am Ende des Wahltages gab es nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Regierung die Wahl verloren hatte, und zwar eindeutig. Der Mythos, die venezolanische Gesellschaft würde mehrheitlich hinter dem Chavismus stehen, wurde an diesem Tag ein für alle Mal zerstört. Die Regierung hat nicht die geringste Chance, wieder Vertrauen von der Bevölkerung zu erhalten. Maduro hat sich mit der Behauptung, er habe die Wahlen gewonnen, gegen die Bevölkerung gestellt und für den Weg der Repression entschieden. In den Tagen nach der Wahl wurden mehr als 2000 Personen inhaftiert, etwa 100 Jugendliche wurden mit Vorwurf des Terrorismus inhaftiert. Dieses brutale Vorgehen hat Angst, Unsicherheit und Verwirrung in der Bevölkerung ausgelöst. Es ist immer noch unklar, wie der repressiven und autoritären Haltung der Regierung begegnet werden soll. Ein Aufstand der Bevölkerung, der die Regierung bedrohen könnte, ist keine Option. Die venezolanische Gesellschaft verfügt schlichtweg über keinen Organisationsgrad, mit dem er gelingen könnte. Zudem haben die Leute Angst. Zweitens ist das, was die Regierung gerade inszeniert, nicht einfach nur die Nichtanerkennung einer Wahlniederlage unter Beibehaltung der bestehenden institutionellen Ordnung. Was in Venezuela gerade passiert, ist die schrittweise Etablierung einer zunehmend autoritären Rechtsordnung. Die Negation der Wahlniederlage ist ein weiterer Schritt in einem Prozess, der sich bereits länger angekündigt hat. In den letzten Jahren hat die Regierung eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, etwa das Gesetz gegen Hass, das Gesetz gegen Terrorismus oder das Gesetz gegen Faschismus. Mit diesen Gesetzen wurden die demokratischen Grundrechte immer mehr eingeschränkt und die Befugnisse der Regierung und des Präsidenten mehr und mehr ausgeweitet. Mit diesen neuen Gesetzen hat die Regierung die politische Debatte im Land verändert, der Ton ist zunehmend autoritär. Konzepte wie Hass oder Terrorismus werden wahllos eingesetzt, um politische Gegner:innen auszuschalten. Der Vorwurf des Terrorismus kann Haftstrafen von 20-30 Jahren zur Folge haben. Was wir gerade beobachten, ist keine improvisierte Reaktion auf eine Wahlniederlage, sondern die schrittweise Durchsetzung eines autoritären Projektes. Allerdings markiert der 28. Juli 2024 einen profunden Wendepunkt in diesem Prozess: Wenn die Souveränität der Bevölkerung und die Verfassung missachtet werden, dann hört die Demokratie auf zu existieren. Hast Du die Reaktion der Regierung so erwartet oder bist Du davon ausgegangen, dass Maduro einen Sieg der Opposition akzeptieren würde? Die Erfahrungen von Übergängen vom Autoritarismus zur Demokratie in den verschiedenen Teilen der Welt haben gezeigt, dass Übergänge meistens ausgehandelt werden, vor allem dann, wenn es keine Kraft gibt, die in der Lage ist, eine Regierung zu besiegen. Es kommt zu einem paktierten Übergang, einem Pakt zwischen alten und neuen politischen Eliten. Das war in Chile zum Ende der Pinochet-Diktatur so, in Spanien, in Griechenland. In Venezuela gab es im Vorfeld zurückliegender Wahlen Diskussionen hierzu. Diesmal war es anders. Anders als sonst, entschied sich die Opposition für die Teilnahme an den Wahlen. In den Jahren zuvor hatte sie zur Wahlenthaltung aufgerufen mit dem Ziel, die Regierung zu delegitimieren, nach dem Motto, „die Regierung betrügt eh, eine Wahlbeteiligung lohnt sich nicht“. Einige Oppositionelle forderten sogar die USA auf, in Venezuela zu intervenieren. Das war diesmal anders. Die Opposition begann sich zu organisieren und für die Wahl zu mobilisieren. Nachdem den meisten der möglichen Oppositionskandidat:innen die Einschreibung zur Wahl verweigert wurde, blieb am Ende fast zufällig Edmundo González als Präsidentschaftskandidat der Opposition übrig. Zu diesem Zeitpunkt ging es für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr darum, wer der Kandidat der Opposition war, sondern darum, Maduro zu besiegen. Das politische Programm war vollkommen egal. Und zwar so sehr, dass innerhalb von zwei Wochen eine Person, die der großen Mehrheit der Bevölkerung völlig unbekannt war, viel mehr Unterstützung in der Bevölkerung erhielt als Maduro. González wurde zu dem Kandidat, der Maduro besiegen konnte. Um auf das Thema der ausgehandelten Übergänge zurückzukommen: In den vergangenen Jahren und besonders in den Monaten vor Wahlen, wurde in Venezuela immer viel über die Möglichkeit von Verhandlungen diskutiert. Gefragt wurde, wie sich die Kosten des Verbleibs für die Regierung erhöhen oder die Kosten des Ausstiegs senken ließen. Das gab es diesmal nicht. María Corina Machado [Anführerin der rechten Opposition, der 2023 die Ausübung politischer Ämter für 15 Jahre seitens der Maduro-Regierung untersagt wurde] sprach stattdessen davon, Maduro inhaftiert sehen zu wollen. Die US-Regierung lobte eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Informationen aus, die es erlauben würden, diesen „Kriminellen“ [Maduro] zu fassen. All das machte jeden Raum für Verhandlungen zu. Der Diskurs der Opposition und die US-Politik haben in gewisser Weise dazu beigetragen, dass Maduro sich radikalisierte. Nach dem Motto: „Wenn die Aufgabe der Präsidentschaft bedeutet, dass sie mich inhaftieren, meine Ersparnisse konfiszieren und der Chavismus als Bewegung zerstört wird, dann bleibt nur eins: Bis zum Ende an der Macht festhalten“. Weder in den Positionen der rechtsgerichteten nationalen Kräfte, noch in jenen der US-Regierung eröffneten sich Chancen für einen Verhandlungsübergang. Du sprichst von der Regierung Maduro als von einem „zivil-militärisch-polizeilichen Regime“. Was meinst Du damit? Die Allianz zwischen Regierung, Militär und Polizei wird zunehmend deutlich. Das war vor den Wahlen bereits so, aber eher diskret, nun wird es immer klarer und öffentlich sichtbar. Nach den Wahlen gab es eine gemeinsame Pressekonferenz des Oberkommandos des Militärs und des Oberkommandos der Polizei, die Maduro absolute Rückendeckung gaben und den Wahlsieg Maduros anerkannten. Das bedeutete einen Bruch. Dass die Militärs autoritäre Regierungen vorbehaltlos unterstützen, ist ein trauriger Teil der Geschichte Lateinamerikas. Aber dass die Polizei sich dem öffentlich anschließt ist ein Novum und weist eindeutig in Richtung Autoritarismus. Als Chávez zum ersten Mal für die Präsidentschaft kandidierte, appellierte er an die zivil-militärische Union, denn er war ein Vertreter des Militärs. Er appellierte an die Idee, dass das Militär zusammen mit zivilen Kräften die Gesellschaft verändern könnte. Das Thema der zivil-militärischen Union gab es also schon vor der ersten Wahl von Chávez zum Präsidenten. Aber wenn zu dieser Union jetzt noch die Polizei hinzugefügt wird, ist das so, wie einen Polizeistaat auszurufen. Das ist sehr ernst. Wie ist die wirtschaftliche Situation im Land? Welche wirtschaftlichen Interessen stehen hinter diesem Bündnis? Die allgemeine Situation des Landes ist katastrophal. Es gibt einen bekannten venezolanischen Wirtschaftswissenschaftler, der vor Kurzem zynisch bemerkte, dass die Situation der venezolanischen Wirtschaft sehr stabil sei. Stabil im Graben, sie bewege sich nicht. Das Inlandsprodukt beträgt etwa 20 Prozent dessen, was es vor 10 Jahren war – ein Einbruch von 80 Prozent der Wertschöpfung in zehn Jahren. So etwas kommt nicht mal in Kriegszeiten vor. Und das bedeutet, dass die Beschäftigungslage katastrophal ist. Der Mindestlohn liegt bei drei Dollar im Monat, das Bildungs- und das Gesundheitssystem brechen zusammen. In den Grundschulen kommen die Lehrer:innen manchmal zwei Tage in der Woche zum Unterrichten. An den anderen Tagen versuchen sie, andere Einkommensquellen zu erschließen, um zu überleben. Die Krankenhäuser erfüllen nicht die Anforderungen des öffentlichen Gesundheitswesens, die Zahl der Krankenschwestern, die das Land verlassen haben, ist extrem hoch. Die Löhne reichen nicht zum Überleben. Insgesamt haben 25-30 Prozent der Bevölkerung das Land verlassen. Die jungen Leute haben das Gefühl, dass sie ihrer Zukunft beraubt wurden, dass wir uns in einem Land befinden, in dem es keine Zukunft gibt. Das Land zu verlassen stellt für viele die einzige reale Alternative dar. Aber wenn die Alternative für die Jüngeren nicht der politische Aktivismus, der soziale Kampf und die Konfrontation mit der Regierung ist, sondern das Verlassen des Landes, weil sie die Hoffnung verloren haben, dann ist das dramatisch. Wie viele Menschen haben ungefähr das Land verlassen? Die Schätzungen variieren, sie liegen zwischen sieben und acht Millionen Menschen in einem Land mit vormals 30 Millionen Einwohner:innen. Die Emigration begann langsam vor etwa zehn Jahren und hat in den letzten sechs Jahren stark zugenommen. Die zweitgrößte Stadt Maracaibo ist wahrscheinlich die Stadt mit der höchsten Abwanderungsrate. Manche schätzen, dass bereits 40 Prozent der ehemaligen Bewohner:innen die Stadt verlassen haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die soziale und materielle Infrastruktur, die Gebäude, den sozialen Zusammenhalt. Alles bricht zusammen. Inwieweit zieht der politisch-militärisch-polizeiliche Block auch wirtschaftliche Vorteile aus der aktuellen Situation? Wie gesagt, die Regierung Chávez war eine zivil-militärische Regierung. Das Militär hatte viel Macht und hatte wichtige Positionen inne, was schon damals zu viel Korruption führte. Eine entscheidende Institution in diesem Zusammenhang war in den Jahren der Chávez-Regierung die Stelle, die für den Kauf von Devisen zuständig war. Der Unterschied zwischen dem offiziellen Dollar, der dort ausgegeben wurde, und dem Marktdollar betrug in einigen Fällen 10 zu 1. Wer also an die Devisen des offiziellen Dollars kam, konnte sich bereichern. Mit einem Wechsel im Direktorium der venezolanischen Zentralbank flog das alles auf. Die neue Direktorin begann die Konten zu überprüfen und stellte fest, dass in jenem Jahr die Ausgaben von 20 Milliarden Dollar nicht belegt waren. Es handelte sich angeblich um Importe des Staates, aber es gab keine Belege dafür, dass sie tatsächlich getätigt worden waren. Allein in einem Jahr. Und sie wurde bald entlassen. Natürlich. Mit Maduro hat sich diese Korruption deutlich verschlimmert. Chávez kam aus dem Militär, er hatte von dort politisch-ideologische Unterstützung und seine Führung war anerkannt. Nicht so bei Maduro, der Zivilist aus einer linken Partei war, der Sozialistischen Einheitspartei Venezuelas. Er musste seine eigene Unterstützung durch das Militär aufbauen, und das tat er im Wesentlichen, indem er die Macht mit dem Militär teilte und viele öffentliche Führungspositionen an das Militär gab. Schon unter Chávez und unter dem Einfluss Kubas wurden viele Unternehmen verstaatlicht, was zur wirtschaftlichen Krise beitrug, denn es fehlte oft ein angemessenes Management, das Interesse an einer Entwicklung der Produktion hatte. Sie wurden staatlich subventioniert. Der Hintergrund der fehlenden Produktivität ist dramatisch: Die Regierung hat in den letzten 25 Jahren nie ein eigenständiges wirtschaftliches Projekt entwickelt. Im Zentrum stand immer die Verteilung des Ölüberschusses. Als diese Überschüsse und die Subventionen nachließen, fehlten die Möglichkeiten eigenständig zu investieren, sich technologisch zu erneuern, Betriebsmittel zu kaufen. Dazu kommen Wirtschaftssanktionen der USA. Beides zusammen hat die Wirtschaft des Landes zerstört. Eine Wirtschaft, die 100 Jahre lang auf der Grundlage von Öl funktioniert hat. Der Staat war der große Verteiler der Öleinnahmen, was die gesamte Wirtschaftstätigkeit aufrechterhielt. Vor ein paar Jahren gab es ein Projekt der Regierung, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch mit der Erschließung des sogenannten Orinoco-Bergbaubogens ( Arco Minero del Orinoco ) entgegenzuwirken. Zusätzlich zum Öl sollten mit Bergbau Devisen ins Land kommen. Wie hat sich dieses super-extraktivistische Projekt entwickelt? Erstens wurde erkannt, dass die Ölförderung als Grundlage der Volkswirtschaft erschöpft ist. Die Fördermöglichkeiten nahmen ab, die starken Preisschwankungen auf dem Weltmarkt führten immer wieder zu Einbrüchen bei den Devisen- und Staatseinnahmen. Gleichzeitig gab es seitens der Bevölkerung die Erwartung, dass die Wirtschaft weiter wachsen würde, der Staat genug Mittel hätte und sich die Lebensbedingungen verbessern würden. Doch es wurde, wie gesagt, kein alternatives Projekt zur Schaffung von Wohlstand entwickelt. So etwas benötigt ja auch Zeit. Stattdessen verkündete die Regierung im Februar 2016, den Bergbau massiv zu fördern. Gerechtfertigt wurde das damit, dass der illegale Kleinbergbau verschwinden müsse, Ordnung zu schaffen sei und große Unternehmen, vor allem Goldfirmen aus Kanada, investieren sollten. Das Gold sollte das Öl ersetzen. Aber das ist nie passiert, unter anderem weil den internationalen Unternehmen die Rechtssicherheit fehlte. Die großen Investoren blieben also aus. Stattdessen entwickelte sich ein informeller Goldbergbau im Orinoco-Gebiet, an dem sich Teile des Militär, die kolumbianische Guerilla ELN, kolumbianische Paramilitärs und verschiedene venezolanische nichtstaatliche Akteure bereichern. Unter diesen Akteuren bildeten sich so genannte Syndikate, also nicht staatliche Gewaltakteure heraus, die die Herrschaft in der Orinoco-Region übernahmen. Sie kontrollieren weite Teile der Region, schlichten lokale Streitigkeiten, kontrollieren den Goldbergbau, bestimmen den Preis, zu dem Gold verkauft werden kann. Kommen denn überhaupt internationale Investitionen nach Venezuela? Welche Rolle spielt dabei die US-Regierung? Aktuell kommen nur sehr wenige ausländische Investitionen ins Land. Anfang Oktober war in der Presse zu lesen, dass die Regierung Biden die Genehmigung für Chevron, in Venezuela Öl zu fördern und in die USA zu exportieren, bis April nächsten Jahres verlängert. Die Venezuela-Politik der US-Regierung ist durch kurzfristige und langfristige Interessen gekennzeichnet, die nicht unbedingt übereinstimmen. Zum einen verfolgt die US-Regierung die Strategie der kurzfristigen Stabilisierung der venezolanischen Situation, das heißt größtmögliche Stabilität im Inneren Venezuelas, um die politischen Kosten einer steigenden venezolanischen Migration im US-Wahlkampf gering zu halten. Nur so ist zu erklären, dass die US-Regierung auf den Wahlbetrug nicht mit mehr Sanktionen reagiert hat. Sie weiß, dass weitere Sanktionen zu verstärkter Migration, weiterer Verschlechterung und größerer Instabilität führen würden. Nach den Wahlen könnte sich dies also ändern. Zum anderen bestimmt der langfristige geopolitische Wettbewerb mit China und der Krieg in der Ukraine die US-Außenpolitik in Bezug auf Venezuela. Die Vereinigten Staaten sind daran interessiert, mehr Öl auf den Markt zu bringen, zur Not eben aus Venezuela, damit die europäischen Staaten nicht in die Versuchung geraten, fossile Energien wieder aus Russland zu kaufen. Gleichzeitig haben die Chinesen die Geduld mit Venezuela verloren. Venezuela schuldet China etwa 60 Milliarden Dollar an Krediten, die es seit einiger Zeit nicht bezahlt hat, die es vermutlich auch nicht bezahlen wird. Eine ökonomische Unterstützung aus China gibt es praktisch nicht mehr. Zwar arbeiten auch weiterhin chinesische Unternehmen in Venezuela, etwa im Bereich Infrastruktur oder Ölförderung. Die unterscheiden sich in Bezug auf Ausbeutung aber nicht von anderen transnationalen Unternehmen. Welche Rolle spielen die Rücküberweisungen der Migrant:innen für die Stabilität der Wirtschaft? Ich kenne keine verlässlichen Schätzungen. Ein beträchtlicher Teil der Menschen, die das Land verlassen haben, stammen aus sozialen Schichten mit niedrigen Einkommen. Ihre Einkommensmöglichkeiten in den Ankunftsländern sind begrenzt. Entsprechend gering sind die Überweisungen nach Venezuela. Dennoch ist natürlich der Unterschied für Familien, die zwischen einem Mindestlohn von 3 Dollar pro Monat in Venezuela und einer Überweisung von 50 Dollar liegen, sehr groß. Das Thema Migration hat in Venezuela eine tiefe gesellschaftliche Wunde erzeugt. Alle sind betroffen; da ist etwa das Drama der Großmütter, die davon überzeugt sind, dass sie ihre Enkel:innen nie wieder sehen werden. Eines der Dinge, die die Kandidatin der Opposition, María Corina Machado, in ihrer Wahlkampagne vorgeschlagen hat, ist, dass die Kinder zurückkehren können sollten, damit die Mütter ihre Kinder sehen können. Das ist etwas, was die Gefühle der Menschen direkt anspricht. Die Migration ist eine Realität, die das soziale Gefüge der venezolanischen Gesellschaft und der Familien zerreißt. Wie fühlt sich die enorme Auswanderung im Alltag an? Was bedeutet das für das soziale Gefüge? Für die verschiedenen sozialen Schichten bedeutet es natürlich Unterschiedliches. Die mittleren und oberen sozialen Schichten haben die Möglichkeit zu reisen und können ihre Verwandten besuchen. In den ärmeren Schichten wird es als eine Art Herzschmerz empfunden, dass etwa Enkelkinder geboren werden und die Großeltern sie nie kennen lernen werden. Da ist dieses Gefühl, dass es sich um einen unumkehrbaren Prozess handelt. Was macht aktuell die Opposition und was machen die sozialen Bewegungen? Bei der Opposition handelt es sich um ein heterogenes Spektrum verschiedener Sektoren. Was in Venezuela als Opposition bezeichnet wird ist ein Bündnis rechter Parteien, das Edmundo González Urrutia und María Corina Machado unterstützte. Offensichtlich dachte dieser Sektor, dass den Umfragen und den Mobilisierungen zufolge die Niederlage der Regierung so absolut vernichtend sein würde, dass die Regierung keine andere Wahl hätte, als die Macht abzugeben. Doch, wie bereits weiter oben erwähnt, war das nicht möglich. Sie hatten viele Beobachter:innen bei den Wahlen, Zeugen bei der Abstimmung, Kopien der Protokolle, die sie veröffentlichten, um die Niederlage zu belegen. Aber anscheinend gab es keinen Plan, wie man den Kampf fortsetzen könnte, falls die Regierung so reagieren würde, wie sie reagiert. Also sind sie gelähmt. María Machado traut sich nicht, die Leute zum Straßenprotest zu mobilisieren, weil es zu viele Repressionen gibt. Sie ist quasi untergetaucht, man hat sie schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Sie ist zwar ständig auf Pressekonferenzen, aber die sind alle virtuell. Es ist schwer zu sagen, wie lange es dauert, bis ihr Aufenthaltsort bekannt wird. Edmundo González hat das Land verlassen und ist mittlerweile in Spanien. Jenseits der rechten Opposition gibt es Sektoren und Gruppen, die die Notwendigkeit der Bildung eines breiten Bündnisses gegen die Regierung erkennen. Die emanzipatorische Linke alleine wird den Widerstand nicht leisten können. Es bedarf einer Art breiten Front zur Verteidigung der Demokratie und der Verfassung. Es gibt einige Schritte in diese Richtung, aber das wird nicht von heute auf morgen geschehen. So hat zum Beispiel einer der Präsidentschaftskandidaten einer Partei, die sich für soziale Fragen einsetzt aber nur sehr wenig Stimmen erhalten hat, eine sehr aktive öffentliche Rolle in den letzten Wochen eingenommen und alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumente genutzt, um den Wahlbetrug anzuprangern. Ende September hat er bei der höchsten Berufungsinstanz Venezuelas, der Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs, einen Antrag auf Aufhebung der Entscheidung der Wahlkammer gestellt, die den Betrug besiegelte. Dafür hat er ein 80-seitiges Papier vorgelegt, in dem er sehr präzise und minutiös alle Artikel der Verfassung, von Wahlgesetzen und gesetzlich geregelter Verfahrensabläufe auflistet, die während der Wahlen verletzt wurden. Eine kleine, mehr oder weniger repräsentative Gruppe der Zivilgesellschaft hat das Dokument unterschrieben, unter anderem wir als Bürger:innen-Plattform zur Verteidigung der Verfassung in Venezuela. Das hat viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erzeugt, was sehr gut war. Die Idee im Moment ist, viele kleinere Aktionen zu unternehmen, um die Kritik und den Druck aufrechtzuerhalten, auch wenn es keinen Masterplan zum Sturz einer Diktatur gibt. Es geht vielmehr darum Kanäle offen zu halten, über die die Menschen ihre Unzufriedenheit ausdrücken, ihren Protest formulieren und artikulieren können. Und es geht aktuell darum, überhaupt wieder Vertrauen herzustellen zum Beispiel mit den konservativen politischen Sektoren, zu denen es viel Misstrauen gibt. Es gibt viele Leute, die schnell von Ultrarechten oder Faschismus sprechen. Ich denke, wir müssen stärker differenzieren und sprachlich abrüsten, wenn wir irgendwie eine breite Allianz aufbauen wollen, bei allen politischen Differenzen, die es klarer Weise gibt. Was bedeutet das? Wie kann das gelingen? Aktuell müssen wir es schaffen vom Links-Rechts-Gegensatz zum Gegensatz zwischen Autoritarismus und Demokratie zu kommen. Wenn das erreicht ist, dann werden wir sehen, wie konkrete Alternativen weiter politisch diskutiert werden und welches Land wir wollen. Aber im Moment ist das einfach nicht möglich. Seit 1999 war Venezuela eine Referenz für die globale Linke. Chávez erklärte um 2007 herum das Ziel, den Sozialismus im 21. Jahrhundert zu verwirklichen. Was können wir als internationalistische globale Linke aus den letzten 25 Jahren in Venezuela lernen? Ich würde diese Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Die erste bezieht sich auf die Notwendigkeit der Selbstkritik hinsichtlich der Bewertung der venezolanischen Entwicklungen. Rückblickend zeigt sich eine große politische Blindheit gegenüber den Entwicklungen in Venezuela. Das hat viel mit einem dogmatischen Glauben an die Revolution zu tun. Es gab in der Tat schon früh Anzeichen autoritärer Tendenzen, etwa den Messianismus von Chávez, die massive Präsenz des Militärs, die Betonung des Extraktivismus, das Fehlen eines alternativen Produktionsmodells. Später, als Chávez in 2007 die Revolution als sozialistisch deklarierte, identifizierte man Sozialismus mit Etatismus, mit jenen Konsequenzen für die Wirtschaft, auf die ich oben hingewiesen habe. Und mit Folgen für die demokratische Basisorganisation. Die erfolgte in den ersten Jahren der Regierung Chávez oft spontan, von unten, mit oder ohne Unterstützung der Regierung, inklusiv und vielfältig und mit umfassenden sozialen Errungenschaften wie der Alphabetisierung, Zugang zu Wasser, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Spätestens die Entscheidung Chávez‘, eine sozialistische Einheitspartei zu gründen, der sich alle Koalitionspartner unterordnen sollten, stellte eine Zäsur dar. Das alles geschah mit einem völligen Mangel an historischem Problembewusstsein, nicht nur hinsichtlich des sowjetischen Sozialismus. In Venezuela gab es in den 1960er Jahren eine sehr ernsthafte Debatte über die Erfahrung des Sozialismus und der Einheitspartei, über Alternativen, über das Verhältnis von Partei und Bewegungen. Diese Diskussion verschwand aus dem politischen Bewusstsein der jüngeren Generationen. Als der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ausgerufen wurde, war es, als würde man von Null beginnen, ohne irgendeinen Blick zurück. Wie kann man nach den Erfahrungen des sowjetischen Sozialismus zur Bildung einer Einheitspartei aufrufen? Irgendetwas aus dieser Geschichte muss man doch lernen im Sinne von „wie können wir verhindern, dass dieselben autoritären Tendenzen entstehen“? Als sich die Revolution für sozialistisch erklärte, nahm der kubanische Einfluss in einem außerordentlich Maße zu. Man schickte viele junge Leute zur ideologischen Schulung nach Kuba. Das waren junge Leute, die absolut an den Sozialismus glaubten, daran, dass dies die Wahrheit war und das, was getan werden musste. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wie diese [etatistische] Vorstellung von sozialistisch und revolutionär die demokratischen Basisorganisationen beeinflusste. Nach und nach wurde ein umfassendes Institutionengefüge von oben aufgebaut, mit klaren Vorgaben, wie die Basisorganisationen, etwa die Gemeinderäte gebildet werden sollten. Es wurde ein ganzer Apparat geschaffen, der absolut vom Staat bestimmt und finanziert wurde. Ab wann nahmen diese starken Regulierungen und Vereinheitlichungen zu? Das war ab 2008 noch unter Chávez. Dann kam das Problem hinzu, dass es abgesehen vom Diskurs, kein alternatives Projekt zum Öl gab, das zur Schaffung von Wohlstand führte. Die angesprochenen lokalen Basisorganisationen wurden auch aus den Öleinnahmen finanziert. Und mit den finanziellen Ressourcen erfolgte die politische Loyalität. Die ehemals reiche Erfahrung der Vielfalt basisdemokratischer Organisation wurde schließlich Teil des Staates und der Partei. Ohne jegliche Autonomie. Was sind die Lehren hieraus? Ist ein anderer, demokratischer „Sozialismus im 21. Jahrhundert“ möglich? Ich bin überzeugt, dass wir die Verbindung zwischen links sein und dem Begriff des Sozialismus vollständig aufgeben müssen. Der Sozialismus als historische Erfahrung ist gescheitert – und zwar überall auf der Welt. In Afrika, in Asien, in Europa, in Osteuropa, in Lateinamerika. Und jede dieser Erfahrungen endete ausnahmslos in einem autoritären Regime. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir denken sollten, der Kapitalismus sei für ewig. Die antikapitalistischen Kämpfe und die Kämpfe dessen, was wir historisch als Linke definiert haben, sind viel breiter angelegt. Viele der theoretischen Interpretationen eines Teils des Marxismus, diese Vorstellungen von Stufen, von der Linearität des historischen Seins, des historischen Subjekts, sind gescheitert. Dennoch haben sie zusammen mit dem Lagerdenken und der Logik des Kalten Krieges in Teilen der Linken weiterhin ein großes Gewicht. So unterstützt das Forum von São Paulo, das wichtigste Bündnis linker Parteien und Bewegungen in Lateinamerika, auch weiterhin die Regierung von Daniel Ortega in Nicaragua und natürlich auch die von Maduro. Damit schaden sie der Linken zutiefst. Denn wenn wir eine Regierung „links“ nennen, die autoritär, repressiv, korrupt und extraktivistisch ist, dann stehen wir auf der Seite der Rechten. Ulrich Brand (Universität Wien) und Kristina Dietz (Universität Kassel) führten das Gespräch Anfang Oktober beim Treffen der vom Anden-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanzierten, seit 2011 bestehenden Permanenten Arbeitsgruppe „Alternativen zu Entwicklung“, deren Mitglied auch Lander ist, der darüber hinaus auch der erwähnten Plattform zur Verteidigung der Verfassung in Venezuela angehört. Foto Edgardo Lander © RLS

Cali, Baku, Rio. Es war ein Herbst der Gipfel. Der Gipfel ohne Höhepunkte, der Gipfel ohne Ankommen – im Sinne von angemessenen und glaubwürdigen Ergebnissen. Als ob die Welt Zeit hätte. Wirbelstürme in der Karibik und den USA, ja selbst in Südeuropa. Taifune in Taiwan und China. Unwetter kennen keine ideologischen - oder Landesgrenzen. Starkregen und Überflutungen in Nepal, Frankreich, in Spanien mit mehr als 200 Todesopfern, ja auch in Österreich. Brände in Griechenland und in Amazonien. In Indien fällt wegen Smog der Schulunterricht aus. Man soll im Haus bleiben. Die Besucher der COP 16 Artenschutz-Konferenz in Cali wurden dort von Ascheregen begrüßt, immer noch eine Begleiterscheinung der Zuckerrohrernte. Bolivien erlebte die schlimmste Naturkatastrophe seiner Geschichte und rief einen nationalen Notstand aus. Rund zehn Millionen Hektar – eine Fläche deutlich größer als Österreich – im amazonischen Umland sind abgebrannt. Im Vorjahr waren es „nur“ 6,3 Millionen Hektar. Es geht um’s Klima, es geht um die Welt. Und immer wieder geht es dabei um Amazonien, ihre „grüne Lunge“. Es geht darum, Kipppunkte zu vermeiden, points of no return , wo die Schäden irreversibel sind und selbst weitere Schäden hervorrufen. In dieser Lage lassen Berichte der Vereinten Nationen und von NGOs aufhorchen, die vor einer gefährlichen Verknüpfung von Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und dem Organisierten Verbrechen in Amazonien warnen, wodurch eine neue Dynamik entsteht. Es war bei einem Lokalaugenschein im TIPNIS, einem Natur- und Indígena-Schutzgebiet (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Securé; letzteres sind zwei Flüsse, die das Schutzgebiet eingrenzen) am Fuße der Andenkette, wo die Berge enden und Amazonien beginnt. Damals waren Proteste von Umweltschützern und indigenen Vertretern gegen ein Straßenbauprojekt durch das unzugängliche Regenwaldgebiet von der Größe Tirols die erste große Herausforderung für die Regierung Morales in Bolivien, weil es ohne die verfassungsmäßig vorgeschriebene Konsultation der indigenen Bevölkerung und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung in Angriff genommen wurde. Drei indigene Völker leben dort: Yuracaré, Moxeños und Chimanes. In der Tat findet die meiste Entwaldung im Umkreis von fünf Kilometern zu einer Straße statt. Im konkreten Fall befürchteten die Gegner des Projekts insbesondere ein weiteres Vordringen des Kokaanbaus und des Kokaingeschäfts im Schutzgebiet. Der oberste Drogenbekämpfer des Landes, in etwa im Rang eines Staatssekretärs, warnte beim Ortstermin vor Vereinfachungen. Das TIPNIS sei ein komplexes Universum. Siedler, unter ihnen Kokabauern, würden illegal vordringen, indigene Gemeinschaften ihren Lebensraum verteidigen. Es gebe aber auch Indígenaführer die selbst in den illegalen Export von Tropenhölzern verstrickt seien. Unlängst hätten seine Spezialkräfte im TIPNIS ein 24-stündiges Feuergefecht mit Kolumbianern gehabt, die dort ein Kokainlabor betrieben. Ich selbst war der Auffassung, dass jedenfalls das Drogengeschäft die Klandestinität suche und eine Straße eher das Vordringen der Sicherheitskräfte erleichtern würde. Das war im Jahr 2011. Triebkraft Drogenhandel Die Kokainproduktion ist für die daran beteiligten Länder sowohl ein wichtiger – wenn auch illegaler – Wirtschaftsfaktor, als auch ein ernstes gesellschaftspolitisches und ökologisches Problem. Kokablätter werden überwiegend an den Ostabhängen der Anden produziert, wo diese nach Amazonien hin abfallen. Bei der Weiterverarbeitung kommen große Mengen verschiedener Chemikalien zum Einsatz, beispielsweise rund 300 Liter Kerosin pro Kilo Kokain-Hydrochlorid. Die drei wichtigsten Produzenten haben jeweils Flächenanteile an Amazonien: Kolumbien (7 Prozent), Peru (13), und Bolivien (8), ergänzt noch durch Brasilien (59 Prozent), das eine wichtige Rolle beim Transit der fertigen Droge zu den Absatzmärkten spielt. Besonders verheerend wirkt sich die jahrzehntelang vorherrschende Politik der Vernichtung von Kokafeldern aus, teilweise durch Besprühen mit Pflanzengift aus der Luft. In Ermangelung tragfähiger Alternativen zogen die Bauern ins Hinterland und legten neue Felder an. Diese Drogenbekämpfungspolitik ohne Nachhaltigkeit brachte alljährlich tolle Ergebnisse in den Statistiken, doch unter dem Strich liegt die Koka- und Kokainproduktion nach beinahe fünf Jahrzehnten dieser Politik heute auf historischem Rekordniveau. Und während sie einerseits so erfolglos war, dass es das illegale Drogengeschäft nicht einmal nötig hatte mit der Produktion in andere Weltregionen auszuweichen* oder auf die Sorte Epadú, deren Blätter zwar weniger Kokain enthalten, die aber unter dem amazonischen Blätterdach gedeihen kann und insofern kaum aufspürbar ist, hat die Kokavernichtung ohne Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre wohl an sich schon Millionen von Hektar (Sub-) Tropischen Regenwald gekostet. Nachdem man in der internationalen Drogenpolitik langsam dabei ist, jahrzehntelang getragene Scheuklappen abzulegen und ganzheitlicher zu denken, öffnete das Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) mit seinem World Drug Report 2023 noch eine andere Perspektive: Ein ganzes Kapitel 4 ist dort der Verschränkung verschiedener krimineller Aktivitäten und der Umweltzerstörung in Amazonien gewidmet. Die Drogenökonomie, so heißt es dort, wirke als Antrieb für andere illegale Aktivitäten und Umweltzerstörung: illegale Landnahme, Abholzung, illegalen Bergbau, illegalen Handel mit Tieren und Pflanzen (Wildlife Crime). Geringe staatliche Präsenz, Armut und Korruption in Amazonien wirken als fruchtbare Nährlösung dafür und als Katalysator für Sekundärkriminalität: Steuer- und Finanzdelikte, Korruption, Totschlag, Überfälle, sexuelle Gewalt, Ausbeutung von Arbeitern und Minderjährigen sowie Gewalt, Mord und Totschlag gegenüber Umweltschützern, Menschenrechtlern und indigenen Völkern. Größer als der Umwelteffekt der Drogenproduktion an sich seien die Folgeschäden der dadurch angefachten Drogenökonomie, zum Beispiel die Anlage von Profiten in Viehzucht, Sojaanbau, im Holzgeschäft und in Goldminen, die oftmals zu Konflikten mit der indigenen Bevölkerung führen. Katalysator Gold Vor 35 Jahren durfte ich als Referent bei einer Menschenrechtsorganisation für das Volk der Yanomami kämpfen und habe dabei einen Film des bekannten Survival-Experten Rüdiger Nehberg und des Filmemachers Wolfgang Brög gegen Puristen in unserem Verband verteidigt. Die beiden hatten sich unter dem Vorwand, für einen deutschen Unterweltler Schwarzgeld investieren zu wollen, bei illegalen Goldsuchern eingeschlichen. Resultat war eine bedrückende Dokumentation über Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen sowie die Untätigkeit der zuständigen brasilianischen Regionalbehörden. Sie hatten dabei auch Yanomami gefilmt, die dies offensichtlich nicht wollten, was kritisiert worden war. Der Film war zur Hauptsendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden und ich verteidigte ihn mit dem Argument, ich könne wohl hunderte politisch korrekter Pressmitteilungen schreiben ohne ein vergleichbar großes Publikum zu erreichen. Genützt hat das alles ohnehin nichts. Die Lage ist heute schlimmer denn je. Es ist schwierig, gegen den Markt anzukämpfen. Das wissen nicht nur Drogenfahnder. Der Goldpreis hat sich seit 2008 verdreifacht. Die größten Produzenten sind China (370 Tonnen), Australien (310); Russland (310), Kanada (200), die USA (170). Erst an 6. Stelle folgt mit Mexiko (120) ein lateinamerikanisches Land, an 11. Peru (90) und an 14. Brasilien (60). Brasilien soll über einige der größten Goldvorkommen verfügen, hauptsächlich im Norden, in Amazonien, auf dem Gebiet der Yanomami. Die Goldförderung in den Andenländern und in Amazonien ist häufig illegal – geht also allenfalls indirekt in die Statistik ein – und ist mit großen Umweltverheerungen verbunden. Oft kommt dabei das giftige Schwermetall Quecksilber zum Einsatz. In Brasilien dürfte die Hälfte der Goldförderung illegal sein und findet – zum Beispiel im Yanomami-Gebiet an der Grenze zu Venezuela – unter Kontrolle der großen brasilianischen Drogenorganisationen, wie dem Primeiro Comando da Capital (PCC) statt, das den Schürfern „Schutz“ anbietet, „Steuern“ verlangt, Schürfstellen kontrolliert und manchmal Maschinen stellt und wartet. In Peru und Bolivien mischt das Comando Vermelho mit, die älteste brasilianische Drogenorganisation, die 1979 in Rio gegründet worden war. Zwischen 2011 und 2021 sei es in Brasilien zu einem Anstieg des Abbaus auf indigenen Territorien um 625 Prozent gekommen, besonders stark seit 2019. Während der Covid-19-Pandemie sei es bei abnehmenden Kontrollen und gekürzten Budgets zu einem regelrechten Goldrausch gekommen, berichtet das UNODC. Von Januar 2019 bis Dezember 2022 war dort der rechtsextreme Jair Bolsonaro Präsident, dem Indianerschutzrechte und Umweltschutz wenig und die Erschließung der „grünen Hölle“ Amazoniens viel bedeuten. Mit desaströsen Folgen, verheerenden Ausbrüchen von Unterernährung und Krankheiten. Besonders betroffen sind die Schutzgebiete der Yanomami mit etwa 30.000 Menschen. 50-90 Prozent von ihnen leiden unter Quecksilbervergiftungen unterschiedlichen Grades sowie unter der Zunahme von Gewalt. In Kolumbien, Peru und Bolivien findet man Gold häufig in den Flüssen an den Ostabhängen der Anden, wo auch die wichtigen Kokaanbaugebiete liegen. In allen diesen Gebieten ist ein signifikanter Anstieg der Mord- und Totschlagsraten festzustellen. Der Preis für einen Barren (ein Kilogramm) liegt mit rund 82.000 € rund doppelt so hoch wie der für ein Kilo Kokain zu Großhandelspreisen in europäischen Metropolen. Wobei mit Kokain im Straßenverkauf dann doch noch weit höhere Preise erzielt werden. Gold stinkt nicht. Im Vergleich zu Kokain ist es viel leichter verkehrsfähig. Ideal zur Geldwäsche. Kolumbien – Ecuador – Connection Machtvolle Drogenorganisationen sind besonders im Dreiländereck zwischen Brasilien, Kolumbien und Peru aktiv, einschließlich in und um die benachbarten Städte Leticia in Kolumbien und Tabatinga in Brasilien sowie Santa Rosa de Yavarí in Peru. Mit ihrer Kontrollfunktion für das Kokaingeschäft und dem Reichtum an ausbeutbaren Ressourcen weist diese Region heute möglicherweise die höchste Dichte von Gruppen der Organisierten Kriminalität auf, vermutet das UNODC. Menschenrechtsorganisationen beziffern die Mord- und Totschlagsrate in Tabatinga mit 106,6, in Leticia mit 60 und in Manaus mit 45 (pro 100.000 Einwohnern; in Deutschland liegt sie bei 0,8, in Österreich bei 0,9). Nördlich davon fließt der Río Putumayo, der weiter östlich in den Amazonas mündet und im Oberlauf über hunderte von Kilometern die Grenze zwischen Kolumbien und Peru beziehungsweise Ecuador bildet. Der Vektor des Kokaingeschäfts verläuft hier stromaufwärts nach Ecuador, das Anfang 2024 in einer Welle der Gewalt versank, weil sich dort die Statthalter mexikanischer Organisationen blutige Revierkämpfe lieferten. Ein Vierteljahrhundert militarisierter Drogenkrieg und Milliarden von US-Hilfen im Rahmen des Plan Colombia haben nichts daran geändert, dass laut dem World Drug Report des UNODC 230.028 Hektar Koka (von insgesamt rund 300.000) in Kolumbien angebaut werden und nach wie vor auch etwa zwei Drittel der Kokainlabore in Kolumbien entdeckt und zerstört werden – fast die Hälfte davon in den südlichen Departments Putumayo und Nariño im Grenzgebiet zu Ecuador. Die Verlagerung des Kokaanbaus in den Süden wird ebenso als Konsequenz des Plan Colombia angesehen wie der Friedensprozess mit der ältesten Guerilla, den 1964 gegründeten Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vor einem Jahrzehnt. Präsident Juan Manuel Santos bekam dafür im Oktober 2016 den Friedensnobelpreis. Der Friedensplan wurde jedoch nur halbherzig vollzogen. Nachfolger Iván Duque lehnte ihn ab. Hunderte früherer Guerillakämpfer, die ihre Waffen abgelegt hatten, wurden später ermordet. Verschiedene ihrer frentes (Fronten i.S. von Abteilungen) , die große Autonomie genossen , hatten sich schon vorher mit dem Drogengeschäft finanziert und machten einfach weiter. Letztlich gelang es dem kolumbianischen Staat nicht, in den früheren Guerillagebieten rechtsstaatliche Präsenz zu schaffen. Durch den Einsatz verbesserter Sorten und Anbaumethoden soll die Ernte nach Berechnungen des UNODC um durchschnittlich 24 Prozent angestiegen sein und durch Optimierung der Weiterverarbeitung auch der Kokainertrag. Solche neuen Hochproduktivitätszonen befinden sich unter Kontrolle rechter Narcoparamilitares , FARC-Dissidenten beziehungsweise des noch aktiven Ejercito de la Liberación Nacional ( ELN ) , einer weiteren Guerilla. Alle zusammen werden sie Grupos Armados Ilegales ( GAI ) genannt. 35 Prozent der Kokaanbaufläche Kolumbiens befinden sich in Zonen, in denen GAI präsent sind. Diese arbeiten fallweise zusammen oder bekriegen sich. Aber alle sind um strikte Kontrolle des Produktionsprozesses bemüht. Im Department Putumayo lassen sich sechs Gruppen identifizieren, die nahezu umfassende Kontrolle ausüben. Die größten sind ehemalige f rentes der FARC , das Comando Frontera und die Frente Carolina Ramírez – und sie bekämpfen sich. Amazon Underworld Im Rahmen des 20. Treffens der Mitgliedsstaaten der UN Konvention gegen das Organisierte Verbrechen treffe ich im Herbst 2024 den NGO-Vertreter Raphael Hoetmer und zwei Indígena-Vertreter aus dem peruanischen Amazonien, die ihre Namen besser nicht veröffentlicht wissen wollen. In ihre Heimatdörfer trauen sie sich nicht zurück. Das Hauptproblem dort sei der Kokainhandel, erzählen sie. Die drei sind in die Wiener UNO-City gekommen, um das Projekt Amazon Underworld vorzustellen, an dem mehrere NGOs und Investigativjournalisten teilgenommen haben. Amazon Underworld machte unter anderem mit Interviews von Behördenvertretern, Sicherheitskräften, Indígenas und verschiedenen illegalen Akteuren vor Ort dort weiter, wo der UN-Bericht aufhört, um zu einem kompletteren Bild der Dynamik des Geschehens zu kommen. In ihrem Bericht erscheint Amazonien als Karte, in der die Grenzgebiete von Brasilien, Französisch Guayana, Surinam, Venezuela, über Kolumbien, Ecuador, Peru bis Bolivien und Paraguay von einem dicken Halbmond verschiedener illegaler Aktivitäten und Akteure umgeben sind. Aus der Nähe besehen handelt es sich dabei um einen bunten Flickenteppich krimineller Akteure; selten besteht Hegemonie, häufig gibt es Konflikte. In 70 Prozent der untersuchten Gemeinden waren irreguläre bewaffnete Gruppen präsent: kolumbianische Guerillas, brasilianische kriminelle Organisationen, venezolanische und peruanische Banden, nicht selten auch unter Duldung oder in Komplizenschaft mit den lokalen Behörden. Dabei komme es auch zu Fällen moderner Sklaverei und Menschenhandel. Die dort lebenden indigenen Gemeinschaften und ihre Territorien spielen eine fundamentale Rolle beim Schutz der Regenwälder und sind gleichzeitig den Attacken der Organisierten Kriminalität ausgesetzt. Im letzten Jahrzehnt, so der Bericht in der Einleitung, sei Amazonien zu einer der gefährlichsten Regionen Lateinamerikas geworden und die marginalisierten Gemeinschaften litten am meisten unter der Gewalt. In Brasilien seien indigene Gemeinden systematisch zum Opfer gewalttätiger Invasionen von Goldsuchern geworden, während man in den neun amazonischen Departments Kolumbiens seit 2020 43 Massaker dokumentiert habe und bewaffnete Gruppen die ländlichen Gemeinden terrorisierten. In Peru rekrutieren Drogenhändler indigene Kinder, um in den Kokapflanzungen zu arbeiten. Guerillagruppen schicken ganze Familien in die illegalen Goldminen. Laut der Menschenrechtsorganisation Global Witness sei einer von fünf Morden, die im Jahr 2022 weltweit gegen Umweltschützer oder Verteidiger ihres Territoriums verübt wurden, in Amazonien geschehen, nämlich 39. Rember Yahuarcani aus dem Volk der Huitoto im peruanischen Amazonien wies auf der Biennale 2024 in Venedig in einem seiner farbenfrohen Großgemälde (Titelbild) darauf hin, dass dort zwischen 2013 und 2023 insgesamt 32 indigene Führer und Führerinnen von Eindringlingen, Drogenhändlern und der Holzmafia ermordet wurden. Ihre amazonische Heimat sei für Indigene einer der gefährlichsten Orte. Eine entscheidende Rolle spielen Straßen. Wie erwähnt, findet die meiste Entwaldung im Umkreis von fünf Kilometern zu einer Straße statt – und in Amazonien entfallen auf einen legalen Straßenkilometer drei illegale. Aber auch andere Infrastruktur erleichtert das Vordringen: illegale Landepisten, desgleichen Flüsse, bevorzugt zur Regenzeit. In Gegenden, wo indigene Territorien fragmentiert, von Straßen durchschnitten oder wirtschaftlich und sozial sehr von städtischen Märkten abhängig sind, wachsen illegale Märkte rasch und machen die indigenen Völker sehr verwundbar, mit der Gefahr einer Desintegration ihrer Gemeinden. In den peruanischen Departments Ucayali und Madre de Dios beispielsweise, wo alle sozialen und politischen Aktivitäten sich mit der illegalen Ökonomie überlappen und sich gegenseitig unterstützen, werden die indigenen Gemeinden dieser Dynamik unterworfen, und wenn sie in der Lage sind Widerstand zu leisten, werden sie bis zu dem Punkt isoliert, dass der Zugang zu ihrem Territorium gefährdet ist. Der Preis, den indigene Organisationen und ihre Führer bezahlen, ist sehr hoch. Sie sind mit Drohungen gegen sich und ihre Familien konfrontiert. Fälle von Gewalt gegen sie werden häufig nicht gut untersucht und bleiben straflos, warnt Amazonia Underworld. Panorama der kriminellen Akteure Das Jahr 2016 brachte in mehrfacher Hinsicht neue kriminelle Dynamiken. Das Friedensabkommen mit der ältesten Guerilla des Halbkontinents, den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), führte dazu, dass Tausende ihre Waffen niederlegten. Die Guerilla hinterließ vielerorts ein Machtvakuum, das nicht mit rechtsstaatlicher Präsenz gefüllt wurde, sondern von rechtsextremen Paramilitärs, kriminellen Banden und FARC-Dissidenten. In Venezuela wurde 2016 ein Gesetz zur Erschließung des Grenzgebiets zu Kolumbien, Brasilien und Guyana verabschiedet, des sogenannten Arco Minero Orinoco . Doch die Regierung Maduro ließ keine Initiativen zur Erschließung durch legalen Bergbau folgen. Das Vakuum füllten venezolanische kriminelle Gruppen, häufig in Kooperation mit lokalen Behörden und Sicherheitskräften, aber auch FARC-Dissidenten und ELN-Guerilleros, die schon länger beim Drogentransit in Venezuela tätig waren. Ebenfalls 2016 wurde auch ein Pakt zwischen drei großen brasilianischen Gruppen der Organisierten Kriminalität aufgekündigt: dem Primero Comando da Capital , dem Comando Vermelho und der Familia do Norte , was zu Revierkämpfen führte. Mit Kleinkriminellen überfüllte Gefängnisse bildeten eine ideale Rekrutierungsquelle. Die kolumbianische ELN hat eine strategische Präsenz zu beiden Seiten der venezolanischen Grenze. Sie kontrolliert die illegale Goldförderung in den venezolanischen Bundesstaaten Amazonas, Bolívar und Delta Amacuro, wie auch die Routen des Drogenhandels nach Guyana und Brasilien entlang des Cayuní-Flusses und des Río Negro. Die FARC hatten historisch eine starke Präsenz im kolumbianischen Amazonien, wo sie die Entwaldung begrenzten, weil sie den Schutz des Blätterdaches suchten. FARC-Dissidenten tun dies wieder. Die Entwaldung ist 2022/23 in den Departments Meta, Caquetá und Guaviare drastisch zurückgegangen. Dort operieren La Segunda Marquetalía (unter Luciano Marín Arango alias Iván Marquez) und Estado Mayor Central – FARC (unter Néstor Gregorio Vera Fernandez alias Iván Mordisco). In Venezuela arbeitet die Frente Acacio Medina im Drogentransfer. Das Primero Comando da Capital (PCC) wurde 1993 im Gefängnis in São Paulo gegründet und ist inzwischen das wichtigste Drogenunternehmen Brasiliens. Traditionell wurden Drogen aus Bolivien und Peru über Paraguay importiert. Mittlerweile ist das PCC auch ins Grenzgebiet zu Venezuela expandiert, wo es über 2.000 Mann verfügen soll und Drogengewinne in die Goldförderung steckt. Verschiedene Quellen berichteten Amazon Underworld, dass das Engagement des PCC dort Supervision, Steuererhebung sowie Dienstleistungen einschließlich Bordellen umfasst. Das Comando Vermelho (CV) ist das älteste Drogenunternehmen Brasiliens. Es wurde 1979 in Rio gegründet und ist in Paraguay und Kolumbien aktiv sowie neuerdings auch in Bolivien und Peru. Die Familia do Norte (FDN) als Drogenorganisation mit Sitz in Manaus wurde in der zweiten Hälfte der Nullerjahre im Zuge von Auseinandersetzungen weitgehend zerrieben und ist teilweise im CV aufgegangen. In Ecuador bekriegen sich Los Lobos und die Choneros , die im Drogenexport tätig sind und jeweils mit unterschiedlichen mexikanischen Organisationen Beziehungen unterhalten. Schlussfolgerungen Amazonien wird im Zusammenhang mit der Klimakrise und einem möglichen ökologischen Kipppunkt diskutiert. Doch bis zu welchem Punkt muss Amazonien vom Organisierten Verbrechen durchdrungen sein um zu sagen, dass die illegalen Ökonomien die Oberhand haben? In manchen Regionen übersteigen die Gewinne aus illegalen Geschäften bereits die behördlichen Budgets. Mit schwacher Präsenz und geringen Mitteln ist der Kampf dagegen ein Ding der Unmöglichkeit, resümiert der Bericht von Amazon Underworld. Seine Empfehlungen beziehen sich auf Kooperation und Informationsaustausch, Stärkung der Grenzsicherheit. Whistleblower und Zeugen müssten geschützt und Korruption bekämpft werden. Die Drogenfahndung einschließlich der zu ihrer Herstellung benötigten Chemikalien sollte intensiviert werden. Umweltprobleme und Gewaltakte sollten in einer grenzüberschreitend zugänglichen Datenbank unter besonderer Berücksichtigung der Erfassung Organisierter Kriminalität dokumentiert werden. Generell sei ganzheitliches Denken erforderlich. Umweltprobleme und Sicherheitsfragen müssten zusammen gedacht werden, Umweltschutzkonferenzen und Sicherheitskonferenzen zusammengeführt. Besonders wichtig sind der Schutz und die Stärkung indigener Gemeinschaften. Der Bericht empfiehlt ferner die Ausweisung grenzüberschreitender Schutzgebiete. Immerhin ein Lichtblick: Mit Gustavo Petro (Kolumbien) und Lula da Silva (Brasilien) haben sich die Präsidenten der wichtigsten Staaten Amazoniens – was Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft betrifft – zu mehr Schutz und Zusammenarbeit bekannt. Www.amazonunderworld.org www.infoamazonia.org www.amazonwatch.org * Koka kann überall dort gedeihen, wo auch Kaffee wächst; so war holländisch Indonesien einstmals ein wichtiger Produzent.
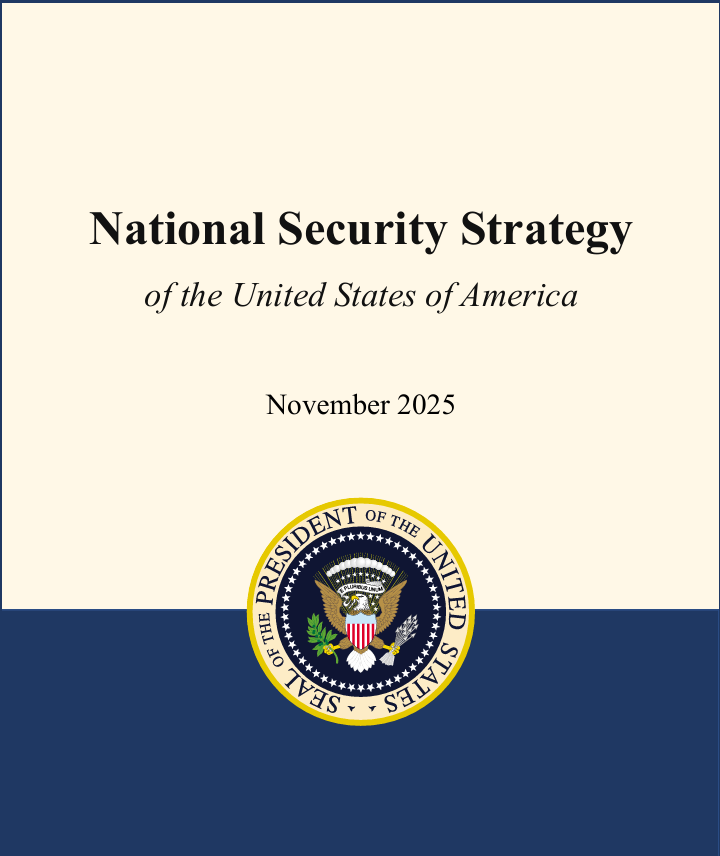
Aus europäischer Sicht mag man darüber spekulieren, ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trumpschen National Security Strategy am 4.12. mit der dreistelligen Millionenstrafe gegen Elon Musks Plattform X (verkündet am 5.12.) durch die Europäische Union zu tun hat. Eine ähnliche Strafe hat es ja bereits im September gegen Google gegeben. Weitere Verfahren gegen US Tech-Giganten – eine Kapitalfraktion, deren Eigentümer zu den reichsten Männern der Welt und den wichtigsten Unterstützern von The Donald gehören – sind in Brüssel anhängig. Vorwürfe über Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Demokratie werden als Umkehr der Tatsachen wahrgenommen und zurückgewiesen, denn sie finden ja gerade unter der Trump-Regierung statt sowie bei deren besonders engen Freunden in Europa. Eine Überempfindlichkeit angesichts der globalen Reichweite des gesamten Papiers einerseits und seiner begrenzten praktisch-politischen Bedeutung als Richtschnur andererseits? National Security Strategies hat es schon viele gegeben: G.W. Bush 2002 und 2006, Obama 2010 und 2015, Trump I 2017, Biden 2021 und 2022. Eine zunehmende Häufigkeit im 21. Jahrhundert mag mit der Volatilität der Weltlage zusammenhängen. Die vorliegende Strategy ist mit 33 Seiten – inklusive Deckblatt und Vorwort – vergleichsweise sehr kurz und pamphlethaft. Seit dem unverschämten Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar sind die Vorwürfe an Europa ja hinlänglich bekannt. Nun hat man es auch noch schwarz auf weiß. Von wirtschaftlichem Niedergang, dem Verlust von Selbstvertrauen und der "starken Gefahr einer zivilisatorischen Auslöschung“ ist da die Rede. Es sei fraglich, ob Europa ein verlässlicher Verbündeter bleibe. Im Zentrum der Kritik steht in der Tat die Europäische Union mit ihrer Regulierungswut sowie multilaterale Regulierungen überhaupt: „The larger issues facing Europe include activities of the European Union and other transnational bodies that undermine political liberty and sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating strife.“ Schon einleitend heißt es unter ‚Prinzipien‘: „We will oppose elite-driven, anti-democratic restrictions of core liberties in Europe, the Anglosphere, and the rest of the democratic world, especially among our allies.“ Und: „We reject the disastrous ‚climate change‘ and ‚Net Zero‘ ideologies that have so greatly harmed Europe, threaten the United States, and subsidize our adversaries.“ Eine Scheidungsurkunde also, wie manche Kommentatoren meinen? Schlimmer! Ein Adoptionsangebot, verbunden mit einer Kriegserklärung gegen universelle Werte wie Menschenrechte, Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat sowie ihre multilateralen Wächter. Europa: „Promoting European Greatness“ Nach allgemeinen Darlegungen zu Zielen, Prinzipien, Strategien und Werkzeugen folgen in der zweiten Hälfte des Papiers die Weltregionen. Der Abschnitt zu Europa ist mit ‚Förderung seiner Größe‘ überschrieben, was wohl nicht als Ausdehnung des Gebiets zu verstehen ist, sondern im Sinne von Großartigkeit. Europa bleibe „strategically and culturally vital to the United States“ . Europa abzuschreiben wäre selbstzerstörerisch. Und: „…the growing influence of patriotic European parties indeed gives cause of great optimism.“ Elon Musks offensive Parteinahme für die deutsche AfD im Wahlkampf kommt da in Erinnerung. Angestrebt ist demnach eine Partnerschaft mit einem Europa der Orbans und Ficos, der AfD und der FPÖ, der PiS, der VOX und des Rassemblement National. Übrigens: Russland wird nur in zwei Absätzen mit seinem Verhältnis zu Europa erwähnt, ansonsten in der ganzen Strategie nicht. In der Tat steht Putin weltanschaulich und gesellschaftspolitisch Trump ja näher als etwa Macron, Starmer oder Sánchez. Beider Denken geht mitunter hinter die Aufklärung zurück. Russland erscheint als wirtschaftlich irrelevant und als keine strategische Bedrohung wahrgenommen zu werden. Die Vision: Eine Welt souveräner Nationalstaaten unter einem starken Führer Auch ansonsten gibt es große Übereinstimmungen in Weltsicht und Selbstbild, angefangen mit der Selbstüberhöhung. Idealbild ist, ähnlich wie bei den Identitären, eine Welt souveräner und kulturell homogener Nationen, die konkurrieren und kooperieren, frei von supranationalen Regulierungen und nach dem Gesetz des Stärkeren. Eine solche Ordnung der Welt sei gottgegeben, Multilateralismus erscheint implizit quasi als Teufelswerk. Die gesamte Strategie ist vom Gedanken an eine natur- oder gottgegebene Überlegenheit der USA als gods own country oder manifest destiny durchtränkt, die teilweise wiederhergestellt werden müsse. An verschiedenen Stellen beruft sie sich auf Gott. Noch häufiger erscheint der Name Trump. „Over the past nine months, we have brought our nation – and the world – back from the brink of catastrophe and disaster. After four years of weakness, extremism, and deadly failures, my administration has moved with urgency and historic speed to restore American strength at home and abroad, and bring peace and stability to our world. No administration in history has achieved so dramatic a turnaround in so short a time. (…) „America is strong and respected again – and because of that, we are making peace all over the world.“ So messianisch beginnt das Vorwort des Präsidenten. Von Russland war bereits die Rede. Einen weiteren Hinweis auf geopolitische Gewichtungen gibt die Länge der jeweiligen Kapitel, wobei Europa mit zweieinhalb Seiten nach Asien und Lateinamerika erst an dritter Stelle kommt, vor Nahost mit zwei und Afrika mit einer halben Seite. Der Nahe Osten erscheint als eine von der Trump-Administration weithin befriedete Region, wo auf der arabischen Halbinsel exzellente Geschäfte winken. Die Rede ist tatsächlich von Frieden, nicht von einem fragilen Waffenstillstand, der täglich gebrochen wird und Todesopfer fordert. Die jeweiligen Regierungs- und Gesellschaftssysteme und ihre Entwicklung solle man dort sich selbst überlassen – im Gegensatz zu Lateinamerika, aber dazu später. Reformen könne man freilich begrüßen. Das gilt auch für die Menschenrechte und offenbar auch für Herrscher, die kritische Journalisten foltern und ermorden lassen. Als geopolitischer roter Faden zieht sich die Eindämmung Chinas durch das ganze Dokument, nicht zuletzt durch das mit sechs Seiten längste, das Asienkapitel. Hier geht es um Marktanteile, legitimen oder unlauteren Wettbewerb und in geostrategischer Hinsicht um die freie Schifffahrt nicht nur im Südchinesischen Meer und um Taiwan, wobei auch hier die Verbündeten einen größeren Eigenbeitrag leisten müssten. Als solche werden ausdrücklich Europa, Japan, Korea, Australien, Kanada und Mexiko genannt. Indien solle hinzugewonnen werden. Um die Zurückdrängung Chinas geht es auch im zweitlängsten Kapitel, dem zu Lateinamerika: „Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine“ Die Überschrift lässt keinen Zweifel daran, worum es geht. Die Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823 definierte Lateinamerika als exklusive Einflusszone der USA und war – keine fünfzig Jahre nach der eigenen Unabhängigkeitserklärung – gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet. Mit der Roosevelt-Corollary (Zusatz) von 1904 behielt sich Washington eine Schiedsrichterrolle bei inneramerikanischen Konflikten und ein exklusives Interventionsrecht vor, wie es bereits in der ersten Verfassung Kubas von 1902 festgeschrieben worden war, das nach dem Sieg im Spanisch-Amerikanischen Krieg den USA zugefallen war. Die Überschrift des Lateinamerika-Kapitels unterstreicht, dass man an diese Tradition anknüpfen will, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Fortsetzung in der containment policy fand, der Eindämmung des „Kommunismus“ - und nach der Revolution von 1959 vor allem Kubas. Unter Marco Rubio, dem Außenminister mit kubanischen Wurzeln, geht es mit anderen Begrifflichkeiten weiterhin darum, vordergründig jedoch um Sicherheit. Nicht im Sinne einer Invasion fremder Truppen über die südliche Landesgrenze, sondern um Migration und Drogen. Darüber hinaus und vor allen Dingen aber geht es um die Zurückdrängung Chinas, den Zugriff auf Rohstoffe und die Schwächung unliebsamer Regierungen, die diesen erschweren. „After years of neglect, the United States will reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere, and to protect our homeland and our access to key geographies throughout the region. We will deny non-Hemispheric competitors the ability to position forces or other threatening capabilities, or to own or control strategically vital assets, in our Hemisphere. This ‚Trump Corollary‘ to the Monroe Doctrine is a common-sense and potent restoration of American power and priorities, consistent with American security interests.“ Dass auswärtige Wettbewerber, zum wirtschaftlichen und strategischen Nachteil der USA, bedeutenden Zutritt zur Region gewinnen konnten, ohne dass sie ernsthaft zurückgedrängt wurden, sei ein großer strategischer Fehler gewesen. „The terms of our alliances, and the terms upon which we provide any kind of aid must be contingent on winding down adversarial outside influence – from control of military installations, ports, and key infrastructure to the purchase of strategic assets broadly defined.“ Die Botschaften der USA sollen sich der Förderung von Geschäftskontakten widmen. „At the same time, we should make every effort to push out foreign companies that build infrastructure in the region.“ Das bezieht sich wohl insbesondere auf den neuen Megahafen in Chancay bei Lima in Peru, der von der chinesischen COSCO gebaut und unlängst eröffnet wurde. Die USA wollen Partner „erster Wahl“ sein … „and will (through various means) discourage their collaboration with others.“ Die Länder der Hemisphäre hätten die Wahl zwischen einer „American-led world of souvereign countries and free economies or a parallel one in which they are influenced by countries on the other side of the world.“ Unter anderem solle auch die Militärpräsenz überdacht werden, was bedeute: „A readjustment of our global military presence to adress urgent threats in our Hemisphere, especially the missions identified in this strategy, and away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years." (Anm. R.L.: siehe die Verlegung der USS Gerald Ford, des größten US Flugzeugträgers, vom Mittelmeer in die Karibik.) (…) „Targeted deployments to secure the border and defeat cartels, including where necessary the use of lethal force to replace the failed law enforcement -only strategy of the last several decades; and Establishing or expanding access in startegically important locations.“ Bereits im einleitenden Teil des Strategiepapiers wird unter ‚Prinzipien‘ deutlich gemacht, dass zwar die Gründerväter in der Unabhängigkeitserklärung den Vorzug für Interventionsverzicht niedergelegt hätten. Aber: „For a country, whose interests are numerous and diverse as ours, rigid adherence to non-interventionism is not possible.“ Die ersten Monate der Trump-Administration gaben reichlich Beispiele dafür, wie man sich das in der Praxis vorzustellen hat: Vom Druck auf die Regierung Panamas, weil ein chinesisches Unternehmen den Ausgang des Panama-Kanals kontrolliere; über Interventionsdrohungen gegen die Regierung Claudia Sheinbaum in Mexiko, damit diese Grenzkontrollen und Drogenbekämpfung intensivieren und militarisieren solle; zu Bestrebungen, den Luftwaffenstützpunkt Manta in Ecuador wieder zu nutzen (was bei einem Referendum von der Wählerschaft zurückgewiesen wurde); über die flagranten Einmischungen in die brasilianische Justiz im Fall des Putschisten Jair Bolsonaro und in die Wahlen in Honduras; bis zum beispiellosen Militäraufmarsch vor der Küste Venezuelas und der Versenkung angeblicher Drogenschnellboote auf offener See, die rein gar nichts zur Linderung der Drogenprobleme in den USA beitragen wird. Letztere bezeichnet der UNO Hochkommissar für Menschenrechte als völkerrechtswidrig und der UN Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismus, der australische Völkerrechtler Professor Ben Saul, spricht von Mord, weil weder eine militärische, noch eine terroristische Bedrohung und schon gar kein Krieg – also auch kein Kriegsverbrechen – vorliege. „Legalität ist eine Machtfrage“ hat Ulrike Meinhof gesagt. Ist es zulässig, eine Terroristin zu zitieren? Vielleicht, wenn es um Terrorismus geht, um die Frage, ob es sich – wie von der Trump-Administration behauptet – um „Narcoterrorismus“ handelt oder um „Staatsterrorismus“. Es muss nicht wirklich verwundern, wenn bei schwierigeren Bedingungen für die Kapitalakkumulation, schärferer Weltmarktkonkurrenz, knappen Rohstoffen und multiplen Krisen Vernunft und gute Sitten über Bord geworfen werden, wenn bellizistische Rhetorik üblich wird, wenn Völker- und Menschenrecht dem Feuilleton überlassen bleiben. Bemerkenswert ist, dass es sich im vorliegenden Papier vielfach um die pseudo-konzeptionelle Untermauerung der realen politischen Praxis handelt, statt um eine Strategie für die Zukunft. Mehr als alles andere wird die Großartigkeit der Vereinigten Staaten und ihres aktuellen Präsidenten beschworen. Anders als im vorliegenden Dokument stehen sich im realen Leben nicht einfach Nationalstaaten gegenüber. Noch gibt es auch in den Vereinigten Staaten eine Opposition, zivilgesellschaftliche Organisationen, unterschiedliche veröffentlichte Meinungen. Der diesseits des Atlantiks üblich gewordene Kotau gegenüber Trump und seiner Regierung ist nicht einfach nur peinlich. Er lässt ihn zuhause erfolgreich dastehen und stärkt ihm den Rücken gegenüber seinen Kritikern. Ob die Lateinamerikaner – Progressisten oder Konservative – von der ihnen zugedachten Rolle als Arena des Ringens zweier Großmächte oder schlicht als Untergebene begeistert sein werden? Bisher gibt es kaum Reaktionen. Interessant ist ferner, was nicht in der Strategie steht: Von einer Einverleibung Kanadas ist so wenig die Rede wie vom Kauf Grönlands. Übrigens: Es gibt auch durchaus richtige Wahrnehmungen und bedenkenswerte Einschätzungen in dem Dokument, das einmal mehr Einblick in die Denkweise seiner Väter gibt. Die darin zum Ausdruck gebrachte Weltsicht ist gefährlich anachronistisch. https://www.whitehouse.gov/up-content/uploads/2025/2025-National-Security-Strategy.pdf
Der Wahlsieg war mit 54:45 Prozent in der Stichwahl ebenso überzeugend wie insgesamt überraschend. Rodrigo Paz Pereira ist auf der großen politischen Bühne seines Landes ein Newcomer. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 17. August hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Seine politische Karriere begann er im Jahr 2002 als Abgeordneter des Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Bewegung der Revolutionären Linken - MIR), das sein Vater, Jaime Paz Zamora (später 60. Präsident von 1989 bis 1993), im Jahr 1971 während der Zeit der Militärdiktaturen im chilenischen Exil mitbegründete. Zwischen 2015 und 2020 war Paz Pereira Bürgermeister seiner Heimatstadt Tarija und ab 2020 Senator von Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadana . Nun gewann er auf dem Ticket der bisher bedeutungslosen Christdemokratischen Partei (PDC) zunächst mit 32,06 Prozent der Stimmen vor dem zweiten Jorge „Tuto“ Quiroga ( Libre ) mit 26,7 Prozent. Die Linke, die mit dem Movimiento al Socialismo (MAS) in den letzten zwei Jahrzehnten seit 2005 stets absolute Mehrheiten erzielt hatte, ist zersplittert und in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. (Wir berichteten in diesem Blog: "Bolivien: Totalschaden für die Linke" und frühere Beiträge.) Das heißt auch: Im Parlament wird sich die neue Regierung Mehrheiten suchen müssen. Der ursprünglich favorisierte Unternehmer Samuel Doria Medina ( Unidad ), der unter Vater Jaime Paz einmal Minister war, landete auf dem dritten Platz und hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt. Ebenso wie der in Umfragen vor der Stichwahl ebenfalls favorisierte klare Verlierer „Tuto“ Quiroga (54:45 Prozent). Alle drei „Parteien“ sind rechts der Mitte zu verorten. Zusammen kämen sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Vergangenheit hatte bei Bedarf die US-Botschaft solche Allianzen geschmiedet. „Kapitalismus für alle…“ …lautet Paz‘ Versprechen. Bolivien ist ein Land ohne Kapitalisten (sprich: unternehmerische Tradition). Bis 1952 beherrschten drei Zinnbarone die wirtschaftlichen und politischen Geschicke. Nach der Revolution von 1952/53 folgte eine Periode des Staatskapitalismus, die politisch unter anderem deshalb scheiterte, weil sich mit Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce und Juan Lechín mehrere Caudillos um die Kontrolle des regierenden Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) stritten. Eine Parallele zur Aktualität: Um die MAS und ihr Erbe stritten sich vor ihrem Niedergang Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez und Eduardo del Castillo. Seinerzeit folgten von 1964 bis 1982 lange Jahre teilweise blutiger Militärdiktaturen. Der Staatskapitalismus dauerte an. Ihm folgte ab 1982 eine gewählte Linksregierung, die 1986 an einer Hyperinflation zerbrach. Der Führer der Revolution von 1952, Víctor Paz Estenssoro, gewann die Wahlen und leitete eine neoliberale Strukturanpassung nach Vorgaben des IWF ein, die bei hohen sozialen Kosten makroökonomische Stabilisierung brachte. Für die maroden Staatsbetriebe wollte sich aber fast ein Jahrzehnt lang kein Käufer finden, bis sie in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Sonderkonditionen überwiegend an ausländische Investoren verhökert wurden. Bolivien wurde zum Aid Regime, ausländische „Entwicklungshilfe“ zum Akkumulationsersatz. Das interne Steueraufkommen reichte oft nicht einmal aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Ein Jahrzehnt später war das Modell gescheitert und die MAS übernahm im Januar 2006 nach einem Erdrutschsieg das Ruder. Das Wirtschaftsmodell soll heute also weniger staatszentriert sein und mehr auf Marktwirtschaft und Privatinvestitionen setzen. Vor allem aber wird es auf Auslandsfinanzierung angewiesen sein. In der Ministerriege fallen erfahrene Technokraten auf. Einige haben für die Vereinten Nationen gearbeitet, andere waren vor 2006 schon einmal Minister. Die Umstellung dürfte weniger rabiat erfolgen als unter der selbsternannten Interimsregierung, die nach der Machtergreifung der Rechten im November 2019 ein Jahr lang nach Kräften versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder auch unter Quiroga, der bereits unter dem Exdiktator Hugo Banzer (1997-2001) einmal als Vizepräsident und nach dessen Krebstod ein Jahr lang bis 2002 auch als Präsident einen strikt neoliberalen Kurs fuhr. Leicht wird es nicht werden. Die Kassen sind leer und das Land leidet seit Monaten unter Treibstoff- sowie Devisenknappheit. Gleich am Tag nach der Amtseinführung konnte der neue Präsident einen Lkw-Konvoi mit hunderten von Zisternen voll Treibstoff begrüßen. Erinnerungen an Chile 1973 drängen sich auf. Eine erste Auslandsreise hatte den designierten Präsidenten schon vorher nach Washington geführt, von wo er Kreditzusagen (die Rede ist von sechs Milliarden US-Dollar) mitbrachte sowie eine Vereinbarung, umgehend wieder diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Zur Erinnerung: Präsident Morales hatte diese nach dem Zivilputsch vom September 2008 abgebrochen; zur Jahrtausendwende entsprachen ausländische „Entwicklungshilfen“ jeweils etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Amtseinführung waren Vertreter Nicaraguas, Venezuelas, Kubas und des Iran ausdrücklich nicht eingeladen. Ein deutliches Zeichen für den Kurswechsel in der Außenpolitik. Ohne Basis, Programm und Struktur Die PDC ist eine Partei ohne Programm und ohne Basis. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt aber ein Spiegelbild der bisherigen Polarisierung. Paz gewann die Stichwahl in sechs von neun Departements (in La Paz, Cochabamba, Potosí und Oruro mit mehr als 60 Prozent). Quiroga gewann in den Tieflanddepartements Santa Cruz und Beni; nahezu gleichauf lagen beide in Tarija. Darin zeigt sich noch einmal die Tragik des politischen Versagens der MAS. Deren frühere Wählerinnen und Wähler im Hochland entschieden sich nun doch eher für die moderate Rechte, zumal der Vizepräsidentschaftskandidat von Libre , Juan Pablo Velasco, wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen war. Damit ist nicht gesagt, dass die neue Regierung auch auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Wählerklientel eingehen wird. Bei der konnte nicht zuletzt der nunmehrige Vizepräsident Edmand Lara punkten, ein Polizist, der aus dem Dienst entlassen worden war, nachdem er Polizeikorruption angeprangert hatte. Der erklärte Bewunderer des salvadorianschen Präsidenten Nayib Bukele erwarb sich so einen Ruf als unbestechlicher Korruptionsbekämpfer und besticht selbst durch fleißiges Posten populistischer Äußerungen auf TikTok. Seinen Amtseid legte er in Polizeiuniform ab. Es gibt Beobachter die meinen, mit ihm als Spitzenkandidat hätte die PDC im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen können. Dementsprechend fällt Lara durch großes Selbstbewusstsein und Ambitionen auf, beklagt mangelnde Kommunikation von Paz mit ihm und betont bei jeder Gelegenheit, er würde in der Regierung nicht fünftes Rad am Wagen sein. Möglich, dass Lara sich als stärkste Oppositionskraft in der eigenen Regierung herausstellt. Übrigens: Laras Frau wurde – wie Quirogas Schwester – schon im ersten Wahlgang auf einem sicheren Listenplatz Abgeordnete. Kapitalismus für alle, das Versprechen dürfte sich neben ausländischen Investoren vielleicht noch für eine neue Mestizo-Bourgeoisie erfüllen, die gestärkt aus dem proceso de cambio der MAS-Jahre hervorgegangen ist. Sie sorgt sich um ihr kürzlich erworbenes Vermögen, scheut staatliche Kontrolle und Interventionismus, möchte aber auch nicht gänzlich auf Regulierung verzichten. Die Umverteilungspolitik der MAS beruhte auf dem Export von Erdgas und Erdöl, auf Extraktivismus, und war von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten abhängig. Die Erschließung neuer Quellen hatte man vernachlässigt, auf Diversifizierung lange verzichtet. Obwohl Bolivien wahrscheinlich auf den weltweit größten Lithiumvorkommen sitzt und man von Anfang an gute Konzepte hatte – nicht nur den Rohstoff wollte man exportieren, sondern zumindest Batterien – ist auch dabei nichts Zählbares weitergegangen. Nachdem sich die Europäer 2019 selbst aus der Poleposition geschossen hatten, auch nicht mit zuletzt chinesischen und russischen Partnern. Die Herausforderungen sind groß. Der informelle Sektor ist weiter angewachsen. 85 Prozent der Menschen sollen ganz oder teilweise auf ihn angewiesen sein. Das Budgetdefizit lag 2024 bei 10,62 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jährlich wiederkehrende Großfeuer und die Vergiftung von Flüssen durch Goldsucher stellen große ökologische Herausforderungen dar. Ob es gelingt, den Kokainhandel weiterhin einzudämmen, ist eine Frage. Hier wird derzeit heiß über eine mögliche Rückkehr der Drug Enforcement Administration (DEA) diskutiert, die aus Gründen der nationalen Souveränität von Morales zusammen mit der US-Botschaft des Landes verwiesen worden war. Schließlich stehen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Verfasstheit an: Im zweiten Kabinett Morales gab es einmal Geschlechterparität. Darüber hinaus ist so wenig passiert wie beim Umweltschutz – den "Rechten der Pachamama“. Feminizide sind an der Tagesordnung. Die öffentliche Sicherheit ist generell ein wachsendes Problem, das Gefängniswesen katastrophal. Fälle indigener Autonomien lassen sich, anderthalb Jahrzehnte nachdem sie vielbeachtetes Novum in der neuen Verfassung waren, an den Fingern einer Hand abzählen. Immerhin: Im Gegensatz zu politischen Gegnern wie Quiroga steht Rodrigo Paz zu Bolivien als plurinationalem Staat, wie er in der Verfassung von 2009 verankert ist, und nicht für eine Rückkehr zur Republik, die stets excluyente und diskriminierend war. Schon in der Woche nach der Amtseinführung wurde ein Dialog mit der Justiz gestartet. Deren erbärmlicher Zustand war mit unterschiedlichen Urteilen zum passiven Wahlrecht von Morales, je nach Maßgabe der jeweiligen Machtverhältnisse, unübersehbar geworden und erreichte bereits in der Woche nach den Wahlen mit der Einstellung von Verfahren sowie der Freilassung von Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom November 2019 seinen Höhepunkt. Zuletzt wurde auch die „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez freigelassen, die den Sicherheitskräften per Dekret Straffreiheit zugesichert hatte. Im nunmehr eingestellten Verfahren ging es unter anderem um die Massaker von Sacaba (15.11.) und Senkata (19.11.) mit zusammen mehr als 20 Todesopfern. Just während dieser Beitrag online ging, hat Präsident Paz den frischernannten Justizminister Freddy Vidovic entlassen, der eine Vorstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes verschwiegen hatte. Vidovic war Anwalt Laras gewesen und der einzige von dessen Gefolgsleuten im Kabinett. Nur Stunden später löste Paz gleich das ganze Justizministerium auf. Ob das der richtige Weg ist? Von der Straffreiheit zur „Unterhaltsamkeit“? Die Absolution für die formal verantwortliche Frau Añez, die von MASistas als „fotogene Barbiepuppe der Putschisten von 2019“ und „Bauernopfer“ angesehen wird, mag nach fünf Jahren gerecht erscheinen. Gingen doch aktive Täter leer aus und wichtige Drahtzieher haben bei den zurückliegenden Wahlen sogar kandidiert, während sie im Frauengefängnis von Miraflores saß. Unterdessen wurde der glücklose Amtsvorgänger Luis Arce, der inzwischen wieder Wirtschaftsvorlesungen an der UMSA ( Universidad Mayor de San Andrés ) gibt, von den Verwaltern des Parteikürzels MAS (die mit 3,1 Prozent der Stimmen gerade noch Parteistatus behalten durfte) aus der Partei ausgeschlossen. Ein weiteres Bauernopfer? Soll so womöglich der Weg für eine Rückkehr von Morales bereitet werden? Letzterer sitzt weiterhin unter dem Schutz seiner Getreuen in einer tropischen Palisadenfestung in seiner Hochburg, dem Kokaanbaugebiet des Chapare. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen ist. Ihm wird vorgeworfen, mit einer seinerzeit 15-jährigen ein Kind gezeugt zu haben. Weil ihm wiederholt minderjährige Frauen ins argentinische Exil zugeführt worden sein sollen, lautet ein weiterer Vorwurf auf Menschenhandel. Mit seinem Aufruf, aus Protest gegen die Nichtzulassung zur Kandidatur ungültig zu wählen, landete der Hauptverantwortliche für den Zerfall der MAS im ersten Wahlgang indirekt immerhin bei rund 15 Prozent, mehr als die anderen Konkurrenten auf der Linken zusammen. Während die sich weiterhin in einer Art Schockstarre zu befinden scheinen, mischt Morales mit seinem kommunalen Radio bereits wieder in der politischen Auseinandersetzung mit. Von einem „Delinquenten mit Territorium, Radiostation und Straflosigkeit“, den man stoppen müsse, sprach der Präsidentenvater Jaime Paz Zamora. Morales sprach ihm seinerseits „die Moral“ zu urteilen ab, weil er in betrunkenem Zustand einen Passanten totgefahren und seinerzeit „Ströme von Blut“ durchschwommen habe, als er 1989 mit dem Exdiktator Banzer koalierte, um den Wahlsieger „Goni“ Sánchez de Lozada auszubremsen und selbst Präsident zu werden. (Vor den Wahlen hatte Jaime Paz damals erklärt: „Von Banzer trennen uns Ströme von Blut“. „Goni“ wurde später zweimal Präsident und noch später im Exil von einem US-Gericht wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt.) Es verbietet sich natürlich, vom Vater auf den Sohn zu schließen. Der erklärte, man habe nicht ein Land im Stillstand übernommen, sondern eine „Kloake der Korruption“ und spricht von „veruntreuten 15 Milliarden Dollar oder mehr“. Was aus den einstmals so starken sozialen Bewegungen wird, ob sie sich erholen? Auch sie sind tief gespalten. Gerade wurde der kürzlich als Chef des mächtigen Gewerkschaftsbundes COB zurückgetretene Juan Carlos Huarachi wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Damit scheinen zumindest einige Wegweiser erkennbar, wie es politisch in Bolivien weitergehen könnte, das bis 2005 fast zwei Jahrhunderte lang als instabilstes Land Lateinamerikas gegolten hatte. Rechtsradikale und Kettensägenpolitiker scheinen dem Land vorerst erspart geblieben zu sein. Doch es könnte „unterhaltsam“ werden – zumindest für unbeteiligte Beobachter.

Während die eigentliche certification für drogenpolitisches Wohlverhalten erst im kommenden Frühjahr verkündet wird, ist der Grundlagenbericht dazu bereits fertig und hat insbesondere in Kolumbien Staub aufgewirbelt. Zusammen mit Afghanistan, Bolivien, Myanmar und Venezuela wird dem traditionell engsten Verbündeten der USA in Südamerika bescheinigt, dass er im zurückliegenden Jahr seinen drogenpolitischen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei ( demonstrably failed wie es heißt). Präsident Gustavo Petro protestierte, hat Waffenkäufe eingefroren und beschuldigt Washington, sich in den Wahlkampf einzumischen. Die mit einer decertification verbundenen Sanktionen wurden aber aus Gründen der nationalen Sicherheit ausgesetzt. Kurios ist das Verdikt im Fall Afghanistan, das ohnehin Sanktionen unterliegt. Dort steigt zwar die Produktion von Cannabis und Amphetaminen. Der Anbau von Schlafmohn wurde im weltweit wichtigsten Ursprungsland für Heroin von den Taliban aber um 95 Prozent reduziert. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen 20 Jahren westlicher Sicherheitskooperation unter Führung Washingtons, wo Schlafmohnanbau und Heroinproduktion alljährlich neue Rekordhöhen erreicht hatten. Nebenbei: Für die USA ist Afghanistan drogenpolitisch eher uninteressant. Ihre illegalen Märkte werden aus Lateinamerika beliefert, insbesondere aus Mexiko und Kolumbien. Auf internationaler Ebene wird das alljährliche Zertifizierungsritual Washingtons schon lange nicht mehr ernst genommen. Pure Symbolpolitik also? Nicht ganz, denn für die Regierung der Vereinigten Staaten ist es ein sehr preiswertes Druckmittel. So nahm die Opposition in Kolumbien den Steilpass aus Washington vor den im Mai 2026 stattfindenden Wahlen dankbar an. Die Linksregierung Gustavo Petro würde den Ruf des Landes ruinieren und ausländische Investitionen gefährden, so etwa die Journalistin und konservative Präkandidatin Vicky Dávila. Das Weiße Haus unterstreicht darüber hinaus, dass sich die Entscheidung ausdrücklich auf die politische Führung des Landes beziehe und lobt die Fähigkeiten und den Mut der kolumbianischen Sicherheitskräfte. US-Außenminister Rubio legte noch nach und nannte Präsident Petro einen „Agenten des Chaos“, seine Politik „irrlichternd“. Zuletzt wurde ihm sogar das Einreisevisum in die USA entzogen. Das renommierte Washington Office on Latin America (WOLA) hingegen kommentierte: Die jahrzehntealte Praxis, andere Staaten durch die certification für ihre angeblich mangelhafte Drogenpolitik zu beurteilen und zu bestrafen, sei ein antiquiertes, grobschlächtiges und kontraproduktives außenpolitisches Instrument und sollte abgeschafft werden. Näheres zu den drogenpolitischen Fakten in Kolumbien und den Ursprüngen der certification im vorangegangenen Beitrag „Drogen: Kolumbien im Visier“. Kanonenbootpolitik Der Militäraufmarsch der USA vor der venezolanischen Küste hat inzwischen Gestalt angenommen und zu ersten Opfern geführt. Am 2. September berichtete Präsident Trump auf seinen sozialen Kanälen, im Rahmen einer von ihm selbst ausdrücklich angeordneten Operation sei ein Boot der venezolanischen „ Tren de Aragua narcoterrorists“ versenkt worden. Ein unscharfes Video zeigte, wie ein mit mehreren Personen besetztes Boot in Flammen aufgeht. Stand heute (27.9.) sollen es vier Schnellboote sein. Die Zahl der getöteten Menschen soll inzwischen bei 17 liegen. Nur im letzten Fall wurden anschließend tatsächlich Drogen aus dem Wasser gefischt. Dominikanische Sicherheitskräfte wollen 1.000 Kilogramm Kokain sichergestellt haben. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei jedenfalls um außergerichtliche Tötungen. Gleich der erste, am besten dokumentierte, Fall, wirft Fragen auf. Weder wurden Drogen präsentiert, noch irgendwelche Beweise vorgelegt, dass das Boot für die Organisation „ Tren de Aragua “ unterwegs war. Nach Recherchen der investigativ-journalistischen Plattformen „The Intercept“ und „InSight Crime“ war das Boot im venezolanischen Bundesstaat Sucre gestartet und hatte außergewöhnlich viele Personen an Bord. Die Rede ist von 11. Die fragliche Route werde für Schmuggelgut aller Art und auch von Migranten genutzt. Ein Versuch, das Boot zu stoppen und zu beschlagnahmen sowie die Besatzung zu verhaften, wurde nicht unternommen, obwohl es nach Darstellung des Außenministers Marco Rubio möglich gewesen wäre. Vielmehr habe es nach einem ersten Angriff umgedreht, sei dann aber durch eine Drohne weiter beschossen worden und in Flammen aufgegangen. WOLA spricht von einer Gruppenexekution auf hoher See. „Polizeiliche Fahndung bringt nichts“, sagte Marco Rubio dazu auf einer Pressekonferenz in Mexiko: „Was sie stoppen wird ist, wenn du sie in die Luft jagst.“ Das Vorgehen ist freilich nicht neu und erinnert an die Operation Airbridge Denial . Ab Mitte der 1990er Jahre waren nicht identifizierte Kleinflugzeuge, die im Verdacht standen, das Zwischenprodukt Pasta Básica de Cocaína aus den Anbaugebieten in Bolivien und Peru zur Weiterverarbeitung nach Kolumbien zu transportieren, zur Landung gezwungen oder notfalls abgeschossen worden. Im April 2001 führte anscheinend ein Kommunikationsfehler zwischen dem US-Aufklärer und dem peruanischen Jäger zum Abschuss einer Cesna mit einer US-Missionarsfamilie an Bord. Zwei Menschen starben und der Congress in Washington stellte Fragen. Das Programm wurde eingestellt. Der Unterschied ist die Unilateralität: Heute sind US-amerikanische Soldaten auch am Abzug. Zu Recht wird die Begründung kritisiert, es handle sich um eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Der gewinnorientierte Drogenhandel, ein kleines Schnellboot gar, soll eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen? Dieser juristische Winkelzug – also die Definition von organisierten Verbrechern des Drogenhandels zur Terrororganisation – dient dazu, dass man nach US-Recht das Militär gegen sie einsetzen darf. Auch dies ist nicht neu. Die Administrationen der Präsidenten Bush und Obama rechtfertigten mit dem „Krieg gegen den Terror“ außergerichtliche Tötungen von Al Qaeda- und Taliban-Führern. Und Präsident Ronald Reagan argumentierte bereits zu Beginn des Jahres 1986 in einer National Security Decision Directive , Drogen seien zu einer Bedrohung der Nationalen Sicherheit geworden. Das diente damals schon dazu, mit den Anti-Drogen-Gesetzespaketen von 1986 und 1988 das Militär in die Drogenkontrolle einzubeziehen. Zunächst an den US-Außengrenzen ( border interdiction ), dann auch in den sogenannten Produzentenländern ( going to the source ). Hohe Militärs wandten damals dagegen ein, sie seien dafür nicht ausgebildet. Search and destroy sei ihre Aufgabe, nicht Verhaftung und Beweisaufnahme. Wenn man sich das Ausmaß der seitdem angewachsenen Drogenimporte und des Drogenkonsums vor Augen führt, so kann man nur sagen: Die Militarisierung der Drogenkontrolle war ein absoluter Holzweg mit sehr hohen Nebenkosten: Teuer, wirkungslos und mit Verletzungen von Menschenrechten sowie der nationalen Souveränität der betroffenen Länder verbunden. Mehrere Kriegsschiffe, ein atomgetriebenes U-Boot und insgesamt 4.000 Soldaten sollen am aktuellen Aufmarsch beteiligt sein. Zehn Kampfjets wurden nach Puerto Rico verlegt, einer nach Guyana, das sich im Grenzstreit mit Venezuela befindet. Der venezolanische Präsident Maduro persönlich wird beschuldigt, in den Drogenhandel verstrickt zu sein, ohne dass dafür Beweise vorgelegt wurden. Auf ihn wurde ein Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen US Dollar ausgesetzt. Venezuela mobilisierte seine Reservisten, und Maduro 2.500 Soldaten und 12 Kriegsschiffe zu einer Militärübung Operation Souveräne Karibik 200 , erklärte aber gleichzeitig seine Gesprächsbereitschaft. Der frühere Chef des US Southern Command, General James Stavridis, fand klare Worte: „ Gunboat diplomacy is back, and it can work .“ Die Regierungen Mexikos, Kolumbiens und Brasiliens warnten vor der Gefahr einer militärischen Konfrontation. Der sagenhafte fliegende Holländer ist dazu verdammt, ewig die Meere zu durchsegeln ohne jemals einen Hafen (ein Ziel) zu erreichen. Die europäischen Verbündeten haben in der Vergangenheit stets alle drogenpolitischen Absurditäten Washingtons und andere außenpolitische Abenteuer (stillschweigend) mitgetragen. Kann der politische Wiedergänger und derzeitige Kapitän des Geisterschiffs auch heute darauf bauen?